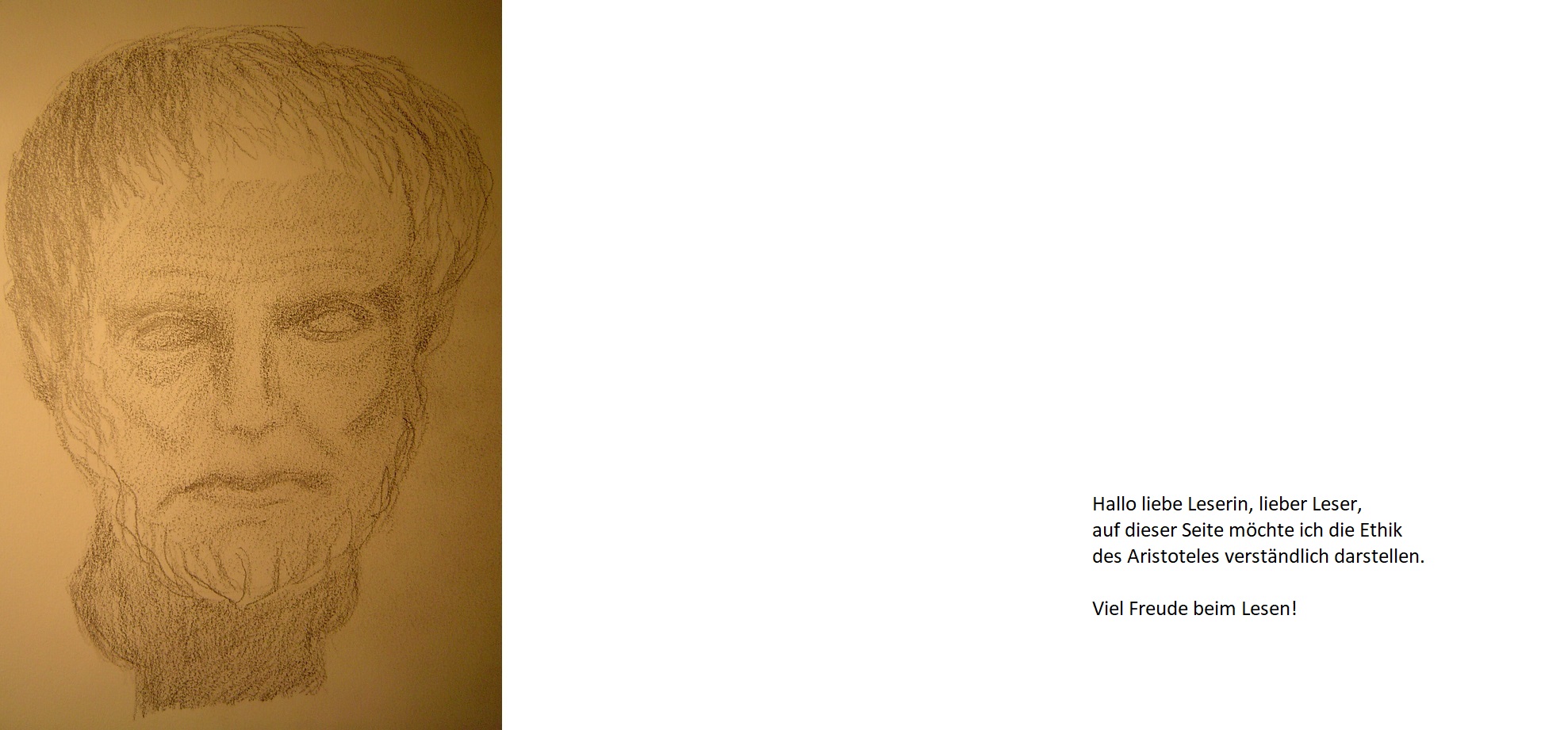Einleitung:
Aristoteles befasst sich in der Eudemischen Ethik im Wesentlichen mit drei Themen: dem Glück, der Tugend und der Freundschaft. Das Glück thematisiert Aristoteles unter dem Aspekt seiner Bedeutung im Leben des Menschen; außerdem geht Aristoteles auf das Glück des Glücksbegünstigten ein.
Sodann befasst sich Aristoteles mit der Tugend, ihren zwei Formen und dem Verhältnis von Tugend und Mitte. Jede Mitte beschreibt einen tugendhaften Habitus. Insgesamt unterscheidet Aristoteles in der Eudemischen Ethik zwölf Mitten: von der Tapferkeit im Umgang mit Gefahren bis zur Gewandtheit beim Scherzen.
Schließlich behandelt Aristoteles die Freundschaft, ihre Arten, das Verhältnis von Freundschaft und Tugend sowie die Freundschaft mit sich selbst.
Ich wünsche dem Leser eine anregende – und hoffentlich verständliche – Lektüre!
Felix H.
Hauptteil:
Buch I, Kap. 1:
Aristoteles hebt zu Beginn des Kapitels die Bedeutung des Glücks hervor. Denn das Glück sei sowohl das Schönste und Beste, als auch das Lustvollste. Im Anschluss daran fragt Aristoteles nach den Ursachen des Glücks. Als mögliche Ursachen des Glücks zieht Aristoteles die Natur, das Lernen, die Gewöhnung, den göttlichen Einfluss und die glückliche Fügung in Erwägung. Drei weitere Ursachen des Glücks scheinen für Aristoteles eine besondere Rolle zu spielen: das theoretische Wissen, die ethische Tugend und die Lust.
Buch I, Kap. 2:
Aristoteles befasst sich mit den Voraussetzungen des Glücks. Wichtig sei es festzustellen, dass das glückliche Leben „nicht identisch“ sei mit den spezifischen Voraussetzungen des Glücks; ähnlich seien die Voraussetzungen für das Gesundsein nicht identisch mit dem Gesundsein selbst.
Buch I, Kap. 3:
Aristoteles unterscheidet zwischen den Meinungen der Wissenden über das Glück und den Meinungen der Vielen. Sich mit den Meinungen der Vielen auseinanderzusetzen erscheint Aristoteles „überflüssig“. Nur die Meinungen der Wissenden möchte er in seiner Vorlesung berücksichtigen.
Buch I, Kap. 4:
Aristoteles kontrastiert bestimmte Lebensweisen, die nicht zu einem glücklichen Leben führten mit solchen, die ihm geeignet erscheinen, zu einem glücklichen Leben beizutragen. Zu den Lebensweisen, die nicht glücklich machten, zählt Aristoteles das Dasein als Handwerker und Lohnarbeiter, das Dasein als Käufer und Verkäufer und alle ‚groben‘ Berufe, deren Mitglieder nur auf das „Protzentum“ hinarbeiteten. Als glückliche Lebensweisen ständen demgegenüber das Leben des Philosophen, der sich um theoretisches Wissen bemühe und das Leben des Politikers, der sich um ethische Tugend bemühe.
Buch I, Kap. 5:
Aristoteles unterscheidet zwischen den wählenswerten und den nicht-wählenswerten Dingen. Zu den Dingen, die nicht wählenswert seien, zählt Aristoteles unter anderem Krankheit, Sturmesnot und auch die Kindheit. Zu den wählenswerten Dingen zählt Aristoteles die tugendhaften Handlungen. Darüber hinaus zitiert Aristoteles Anaxagoras und Sardanapal. Anaxagoras halte das theoretische Wissen für wählenswert, Sardanapal die körperliche Lust. Dementsprechend unterscheidet Aristoteles drei Meinungsrichtungen über das Glück. Denn für die einen liege das Glück im politischen Leben, für die anderen liege es im philosophischen Leben, während wiederum andere das Glück in der körperlichen Lust suchten.
Buch I, Kap. 6:
In diesem Kapitel macht Aristoteles einen Exkurs zu der Frage, wie man philosophieren soll. Aristoteles rät unter anderem dazu, logisch zu argumentieren und Erfahrungstatsachen als Beispiele zu nutzen.
Buch I, Kap. 7:
Aristoteles hebt den Rang des Glücks hervor. Denn das Glück sei „das bedeutendste und hochwertigste unter den menschlichen Gütern“. Anschließend stellt Aristoteles fest, dass das Glück bei den Göttern womöglich vorkommen könne; die Tiere hingegen könnten nicht glücklich sein.
Buch I, Kap. 8:
Aristoteles zitiert einige Autoren, die meinen, dass das Glück eine Idee sei. Aristoteles widerspricht dieser Auffassung. Denn das Glück, verstanden als Idee, sei „reine Abstraktion und inhaltsleer“. Außerdem sei die Idee „unveränderlich und nicht Gegenstand des Handelns“. Das Glück sei aber für den Menschen das Gut, „worumwillen (gehandelt wird)“ und „das Endziel dessen was der Mensch durch sein Handeln verwirklichen kann.“
Buch II, Kap. 1:
Aristoteles unterscheidet zwischen Gütern in der Seele und Gütern außerhalb der Seele. Aristoteles meint, dass die Güter in der Seele „wählenswerter“ seien als die Güter außerhalb der Seele. Denn theoretisches Wissen, ethische Tugend und Lust seien Güter in der Seele, die „nach allgemeiner Überzeugung […] entweder einzeln genommen oder alle (drei) Endziel“ menschlichen Handelns seien.
Anschließend stellt Aristoteles die These auf, dass das Glück auf dem „Tätigsein der […] (tugendhaften) Seele“ beruhe. Denn im Schlaf, das heißt bei „Passivität […] der Seele“, seien die Tugendhaften und „die Minderwertigen“ sich nicht unähnlich. Sodann unterscheidet Aristoteles zwei Formen der Tugend. Der Mensch könne zum einen eine Tugend des Charakters oder ethische Tugend besitzen, wenn er zum Beispiel freundlich oder gerecht sei. Zum anderen könne der Mensch auch eine Tugend des Verstandes oder „dianoetische“ Tugend haben, wenn er sachkundig oder weise sei.
Buch II, Kap. 2:
Aristoteles definiert den Charakter als die „Beschaffenheit des irrationalen Seelenelements“. Aristoteles hebt hervor, dass das irrationale Seelenelement in der Lage sei, dem rationalen Seelenteil zu gehorchen. Woran ein Mensch sich gewöhne, präge seinen Charakter.
Buch II, Kap. 3:
Zu Beginn des Kapitels betont Aristoteles, dass die auf uns bezogene Mitte „das Beste“ sei. Denn diese Mitte sei so wie „die planende Überlegung“ befehle. Die Mitte zu treffen bedeute also ethisch tugendhaft zu sein.
Im Folgenden nennt Aristoteles zahlreiche Beispiele für charakterliche Extreme. Bei diesen Extremen werde die Mitte entweder durch ein Zuwenig oder durch ein Zuviel verfehlt. Zum Beispiel zürne der Jähzornige zu viel, der Phlegmatische zu wenig; der Feige fürchte zu viel, der Tollkühne zu wenig. Der Zuchtlose begehre das Lustvolle zu sehr, der Stumpfsinnige begehre das Lustbringende hingegen zu wenig, usw.
Buch II, Kap. 4:
Aristoteles unterscheidet zwischen Verstandestugenden oder dianoetischen Tugenden und ethischen Tugenden. Dianoetisch tugendhaft sei der, der die „Wahrheit“ gut erkennen könne. Aristoteles führt dazu näher aus, dass der dianoetisch Tugendhafte das „Wie (der seienden Dinge)“ gut erkennen könne oder die Ursachen bestimmter Dinge. Die dianoetischen Tugenden bezögen sich auf den rationalen Teil der Seele. Die ethischen Tugenden bezögen sich hingegen auf den irrationalen Teil der Seele. Das Ausmaß an Tugendhaftigkeit des Charakters hänge davon ab, welche „Lust- und Unlustformen“ er verfolge oder meide.
Buch II, Kap. 5:
Aristoteles betont, dass die Abweichung von der Mitte mal in Richtung des Übermaßes, mal in Richtung des Unterschusses schädlicher sein könne. So sei es zum Beispiel für die körperliche Gesundheit besser, wenn jemand eher zu viel als zu wenig trainiere. Umgekehrt sei es gesünder, eher zu wenig zu essen als zu viel.
Buch II, Kap. 6:
Aristoteles unterscheidet zwischen Tugend und Minderwertigkeit. Die Tugend verdiene Lob, der Minderwertigkeit komme Tadel zu. Lob und Tadel bezögen sich nicht auf das, „was durch Notwendigkeit, Zufall oder [durch die] Natur“ sei. Vielmehr bezögen sich Lob und Tadel auf die Dinge, „deren Urheber wir persönlich sind“. Urheber sei der Mensch von dem, was er „willentlich“ plane und umsetze.
Buch II, Kap. 7:
Aristoteles beschreibt, was der Begriff ‚willentlich‘ nicht bedeutet. Willentlich zu handeln bedeute nicht, aus Begierde zu handeln. Denn wer aus der Begierde handele, tue etwas „im Widerspruch zu dem […] was man für das Beste hält.“ Willentlich bedeute auch nicht, aus Zorn zu handeln. Denn der Mensch tue vieles willentlich, ohne zornig zu sein. Schließlich bedeute willentlich zu handeln auch nicht, aus dem Wunsch heraus zu handeln. Denn keiner wünsche „nämlich was er für schädlich [halte] und doch [tue] man es, wenn man unbeherrscht“ werde.
Buch II, Kap. 8:
Aristoteles nähert sich dem, was ‚willentlich‘ heißt, an dem Charakterzug der Beherrschung. Der Beherrschte „bewegt sich in der Richtung der Überredung, die er in sich vollzogen hat und geht seinen Weg nicht unter Zwang, sondern willentlich.“
Buch II, Kap. 9:
Aristoteles definiert ‚willentlich‘ als eine Handlung, die jemand getan habe ohne sie tun zu müssen, und zwar getan habe mit Wissen um „Sache, Mittel [und] Person“ des Adressaten.
Buch II, Kap. 10:
In diesem Kapitel definiert Aristoteles den Begriff der Entscheidung. Eine Entscheidung sei eine Mischung aus Meinung und Wunsch und gründe darauf, dass jemand mit sich zu Rate gegangen sei. Die Entscheidung betreffe immer die Mittel, die zur Erreichung eines Ziels gewählt werden sollen. Zum Beispiel könne Gegenstand einer Entscheidung der Spaziergang sein; die Gesundheit sei dann der Zweck des Spaziergangs. Aristoteles betont, dass das durch Entscheidung zustande gekommene Handeln „durchweg etwas Willentliches“ sei. Denn bei der Entscheidung berieten wir in uns.
Buch II, Kap. 11:
In diesem letzten Kapitel von Buch II betont Aristoteles, dass tugendhaftes und untugendhaftes Handeln willentlich seien. Denn in der Regel werde niemand gezwungen, etwas Schlimmes zu tun. – Die Tugend wähle die Ziele aus. Denn Ziele könnten weder durch schlussfolgerndes, noch durch beratendes Denken bestimmt werden. Ziel sei zum Beispiel die Gesundheit des Patienten.
Buch III, Kap. 1:
Aristoteles thematisiert den Charakter des Tapferen, des Ängstlichen und des Tollkühnen. Der Tapfere fürchte weder zu viel, noch zu wenig. Außerdem sei der Tapfere angemessen zuversichtlich. Ferner könne der Tapfere die Wirklichkeit am besten einschätzen.Der Feige hingegen fürchte zu viel und sei zu wenig zuversichtlich. Der Feige werde durch seine Feigheit getäuscht. Denn harmlose Dinge halte er für gefährlich. Der Tollkühne fürchte zu wenig und sei zu zuversichtlich. Auch der Tollkühne werde durch seine Tollkühnheit getäuscht. Denn gefährliche Dinge halte er für anspornend.
Die Tapferkeit sei die mittlere Haltung zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Nur der Tapfere sei tugendhaft. Nur der Tapfere gehorche der Vernunft.
Buch III, Kap. 2:
Aristoteles unterscheidet den Besonnenen, den Zuchtlosen und den Stumpfsinnigen. Der Besonnene empfinde für alles Taktil-Wahrnehmbare weder zu viel, noch zu wenig Lust. Der Zuchtlose empfinde zu viel Lust für das Taktil-Wahrnehmbare. Er esse und trinke zum Beispiel zu gerne und zu viel. Der Stumpfsinnige empfinde hingegen zu wenig Lust für das Taktil-Wahrnehmbare. Die Besonnenheit stelle die Mitte zwischen Zuchtlosigkeit und Stumpfsinn dar. Aristoteles betont, dass es nur wenige stumpfsinnige Menschen gebe.
Buch III, Kap. 3:
Aristoteles unterscheidet den Gelassenen, den Gereizten und den Sklavischen. Der Gelassene zürne weder zu viel, noch zu wenig. Der Gereizte zürne zu viel; der Sklavische zürne hingegen zu wenig. Aristoteles betont, dass die Gelassenheit die Mitte zwischen dem Gereizten einerseits und dem Sklavischen andererseits sei. Und dass die Gelassenheit als mittlerer Habitus die Tugend sei.
Buch III, Kap. 4:
Aristoteles unterscheidet den Großzügigen, den Knauserigen und den Verschwender. Der Großzügige empfinde beim Erwerb von Geld so viel Lust >wie die rechte Planung< befehle und beim Verlust von Geld so viel Unlust wie die rechte Planung vorgebe. Der Knauserige habe am Erwerb von Geld „mehr Lust […] als recht ist“ und am Ausgeben von Geld „mehr Unlust als recht ist“. Der Verschwender empfinde beim Gelderwerb zu wenig Lust und empfinde beim Geldausgeben zu wenig Unlust. Aristoteles betont, dass die Großzügigkeit die Mitte zwischen Knauserigkeit und Verschwendung sei.
Buch III, Kap. 5:
Aristoteles unterscheidet den Hochsinnigen, den Aufgeblasenen und den Engsinnigen. Der Hochsinnige halte sich großer Güter für wert und sei dieser auch wert. Der Aufgeblasene halte sich höherer Ämter für wert als er tatsächlich wert sei. Der Engsinnige halte sich geringerer Ämter für wert als er tatsächlich wert sei. Aristoteles betont, dass die Hochsinnigkeit die Mitte zwischen Aufgeblasenheit und Engsinnigkeit sei.
Buch III, Kap. 6:
Aristoteles unterscheidet den Großartigen, den Großtuer und den Engherzigen. Der Großartige treibe bei Festen „in angemessener Weise Aufwand“. Der Großtuer tendiere bei der Ausrichtung von Festen zu taktlosem Aufwand. Der Engherzige gebe bei großen Festen, wie zum Beispiel einer Hochzeit, hingegen zu wenig aus. Allein der Großartige treibe den Aufwand so, wie die Vernunft es gebiete.
Buch III, Kap. 7:
In diesem letzten Kapitel von Buch III thematisiert Aristoteles verschiedene Mitten. Zunächst unterscheidet Aristoteles den Mann der gerechten Empörung, den Missgünstigen und den Schadenfrohen. Der Mann der gerechten Empörung habe den mittleren Habitus. Als nächstes unterscheidet Aristoteles den Mann der echten Scheu, den Hemmungslosen und den Schüchternen. Der Mann der echten Scheu halte sich an die Meinung der tatsächlich Tugendhaften.
Der Hemmungslose nehme keinen anderen ernst. Der Schüchterne nehme jedes fremde Urteil ernst, ohne zu bedenken, wer es getroffen habe. Sodann unterscheidet Aristoteles den Freundschaftlichen, den Widerwärtigen und den Schmeichler. Der Freundschaftliche mache das mit, was ihm als gut erscheine. Der Widerwärtige opponiere zu viel. Der Schmeichler hingegen richte „sich leichterhand in allem nach den Wünschen (des anderen)“.
Als nächstes unterscheidet Aristoteles den Mann mit Würde, den Selbstgefälligen und den Unterwürfigen. Der Mann mit Würde passe sich dem tugendhaften Mitbürger an. Der Selbstgefällige passe sich niemandem an. Der Unterwürfige dagegen stelle sich „in allem“ auf andere ein. Schließlich unterscheidet Aristoteles den Aufrichtigen, den hintergründig Bescheidenen und den Aufschneider. Der Aufrichtige spreche ehrlich über seine Stärken und Schwächen. Der Aufschneider vergrößere seine Stärken anderen gegenüber. Der hintergründig Bescheidene verkleinere sich hingegen „in voller Bewußtheit“. Zuletzt unterscheidet Aristoteles den Gewandten, den Humorlosen und den „Hanswurst.“ Der Gewandte lache nur über das, über das man lachen darf. Der Humorlose lasse „überhaupt keinen Spaß an sich heran“. Der Hanswurst hingegen lache über alles. Aristoteles betont, dass nur der Gewandte seiner Vernunft folge.
Buch VII, Kap. 1:
Aristoteles wendet sich der Freundschaft zu. Eine Erörterung über die Freundschaft sei nicht weniger wert als die Erörterung über die Tugenden. Aristoteles betont, dass es die „Hauptaufgabe der Staatskunst“ sei, „Freundschaft zu stiften“. Die Tugend sei eine Voraussetzung für die Freundschaft. Denn „unmöglich könnten Bürger einander freund sein, wenn sie untereinander Unrecht verübten.“
Buch VII, Kap. 2:
Aristoteles unterscheidet die Tugend-Freundschaft, die Lust-Freundschaft und die Nutzen-Freundschaft. Die Tugendfreunde schätzten einander als Person. Die Tugend-Freundschaft gebe es nur unter den tugendhaften Menschen. Die Lustfreunde seien sich wechselseitig angenehm und deshalb miteinander befreundet. Die Nutzenfreunde seien sich untereinander nützlich und deshalb befreundet. Allein die Tugend-Freundschaft sei dem Menschen möglich; die Freundschaft aufgrund des Nutzens und der Lust gebe es auch bei den Tieren.
Buch VII, Kap. 3:
Aristoteles unterscheidet eine Art von Freundschaft, die auf „Gleichheit“ der Partner beruhe und eine Art von Freundschaft, bei der ein Partner dem anderen überlegen sei. Als Beispiele für eine Freundschaft, bei der ein Partner dem anderen überlegen sei, nennt Aristoteles das Verhältnis von Vater zu Sohn und das Verhältnis von Mann zu Frau.
Buch VII, Kap. 4:
Aristoteles betont, dass „(echte) Freunde“ nur die sein könnten, deren Freundschaft auf „Gleichheit“ beruhe. „Denn es wäre absurd, wenn ein Mann eines Kindes Freund sein sollte“.
Buch VII, Kap. 5:
Aristoteles wirft die Frage auf, ob Gleiche oder Gegensätzliche miteinander befreundet sind. Grundsätzlich seien die Gleichen miteinander befreundet. Denn „das Gute“ sei sich „gleich“. Außerdem könnten die Gleichen auch im Sinne der Lust-Freundschaft miteinander befreundet sein. „Denn für die die (einander) gleich sind, ist das nämliche lustvoll.“ Aber auch Gegensätzliche könnten aneinander „Vergnügen finden“. Die Gegensätzlichen würden je dafür sorgen, dass der andere „in den mittleren Zustand“ versetzt werde. Gegensätzliche seien zum Beispiel der Trockene und der Witzige.
Buch VII, Kap. 6:
Aristoteles thematisiert die Freundschaft mit sich selbst. Dabei greift Aristoteles auf sein Konzept der menschlichen Seele zurück. Die Seele des Menschen bestehe im Wesentlichen aus zwei Teilen: aus der Vernunft und aus der Begierde. Die Freundschaft mit sich selbst beruhe darauf, dass kein Zwiespalt zwischen Vernunft und Begierde bestehe. Oder anders gesagt: Nur der, der seiner Vernunft folge, könne eine Freundschaft mit sich selbst haben.
Buch VII, Kap. 7:
Aristoteles thematisiert das Wohlwollen und die Eintracht. Das Wohlwollen definiert Aristoteles als den Anfang der Tugend-Freundschaft. Die Eintracht sei die Freundschaft unter Bürgern.
Buch VII, Kap. 8:
Aristoteles betont, dass die Eltern ihre Kinder lieben würden. Die Liebe der Mütter zu ihren Kindern sei größer als die Liebe der Väter. Denn die Mütter hätten durch die Geburt das größere Werk zu vollbringen.
Buch VII, Kap. 9:
Aristoteles greift auf seine Unterscheidung der Verfassungsformen zurück. Demnach gibt es die Königsherrschaft, die Aristokratie und die Politie als gute oder ‚echte‘ Verfassungen. Analog zur Königsherrschaft gibt es die Tyrannis als schlechte oder ‚entartete‘ Verfassung; analog zur Aristokratie die Oligarchie als entartete Verfassung und analog zur Politie die Demokratie als
entartete Verfassung. Aristoteles betont nun, dass sich alle Verfassungsformen in der Familie wiederfänden: Im guten Fall liege beim Familienvater die Königsherrschaft, im schlechten Fall sei der Vater ein Tyrann. Im günstigen Fall ständen Mann und Frau in einem aristokratischen Verhältnis; im ungünstigen Fall ständen Mann und Frau in einem oligarchischen Verhältnis. Und die Brüder ständen im günstigen Fall in einem Verhältnis der Politie; im ungünstigen Fall in einem demokratischen Verhältnis. ‒
Aristoteles unterscheidet das quantitativ und das proportional Gleiche. Das quantitativ Gleiche komme zum Beispiel den Brüdern zu. Das proportional Gleiche gelte für Beziehungen mit Über-/ Unterordnung, zum Beispiel für das Verhältnis von Vater und Sohn.
Buch VII, Kap. 10:
Aristoteles betont, dass Streit am häufigsten in der Nutzen-Freundschaft herrsche. Denn in der Tugend-Freundschaft dominiere die Tugend; wo die Tugend aber sei, da sei kein Streit. Und in der Lustfreundschaft trenne „man sich, nachdem jeder seinen Teil gegeben und erhalten hat“. Um die Streitereien in der Nutzen-Freundschaft zu vermeiden, empfiehlt Aristoteles den Partnern, einen Vertrag untereinander zu schließen.
Buch VII, Kap. 11:
Aristoteles betont, dass man „wohl einiges dem Freund […], der nützlich ist“ zu leisten habe. Man habe dem Freund, „der gut ist“ anderes zu leisten als dem Freund, der nützlich sei. Wahrscheinlich meint Aristoteles, dass man dem Tugendfreund mehr geben muss als dem Nutzenfreund.
Buch VII, Kap. 12:
Aristoteles betont, dass der tugendhafte Mensch danach strebe, viele Freunde zu haben. Deshalb unterscheide sich auch das Glück der Götter vom Glück der Menschen: Denn die Götter bräuchten keinen Freund; ihr Glück bestehe darin, sich selbst zu denken. Für den Menschen hingegen sei das Zusammensein mit Freunden sehr lustvoll, insbesondere dann, wenn es beiden Freunden gut gehe.
Buch VIII, Kap. 1:
Aristoteles zitiert Sokrates, demzufolge sittliche Einsicht ein >Wissen< sei. Aristoteles widerspricht dieser Auffassung und behauptet, dass die sittliche Einsicht eine „Art des Erkennens“ sei.
Buch VIII, Kap. 2:
Aristoteles thematisiert den Glücksbegünstigten. Der Glücksbegünstigte handele seinem Impuls entsprechend, ohne Einsicht und ohne dabei zu denken. Als Beispiel für einen Glücksbegünstigten nennt Aristoteles den Musikalischen, der ohne Technik singe – und trotzdem Erfolg habe. Aristoteles betont, dass der Impuls, zum Beispiel ein Musikalischer zu sein, etwas Göttliches sei.
Buch VIII, Kap. 3:
Im letzten Kapitel der Eudemischen Ethik unterscheidet Aristoteles den guten Menschen und den Menschen, der schön und gut ist. Gut sei der Mensch, wenn er tugendhaft sei. Ein guter Mensch könne tugendhaft handeln um der Tugend selbst willen oder um durch tugendhaftes Handeln zu äußeren Gütern, wie z. B. zu Geld, zu kommen. Nur der gute Mensch, der tugendhaft handele um der Tugend selbst willen, sei ein Mensch, der schön und gut sei. Der andere, der tugendhaft handele mit dem Ziel, etwa reich zu werden, sei lediglich ein Mensch, der gut sei, aber nicht schön und gut.
Schluss:
Das Glück ist das große Thema in der aristotelischen Ethik. Der Weg zum Glück beruhe auf dem Tätigsein der tugendhaften Seele, wie Aristoteles in Buch II, Kapitel 1 sagt. Die Seele ist nach Aristoteles dann tugendhaft, wenn sie dianoetisch und ethisch tugendhaft ist.
Dianoetisch tugendhaft sei die Seele, wenn sie die Dinge gut erkennen und erklären könne (vgl. Buch II, Kapitel 4). Ethisch tugendhaft sei die Seele dann, wenn sie einen mittleren Habitus auf jedem Gebiet aufweise. Sie weise einen mittleren Habitus immer dann auf, wenn sie der Vernunft folge (vgl. Buch III, Kapitel 1, 6 und 7).
So ist die Eudemische Ethik nicht nur eine Ethik der Mitte, sondern auch ein Lob der Vernunft.
Felix H.
Literatur:
Aristoteles: Eudemische Ethik, übersetzt und kommentiert von Fr. Dirlmeier, in: Aristoteles, Werke in deutscher Übersetzung, begründet von E. Grumach, hrsg. von H. Flashar, Bd. 7, Berlin 41984.