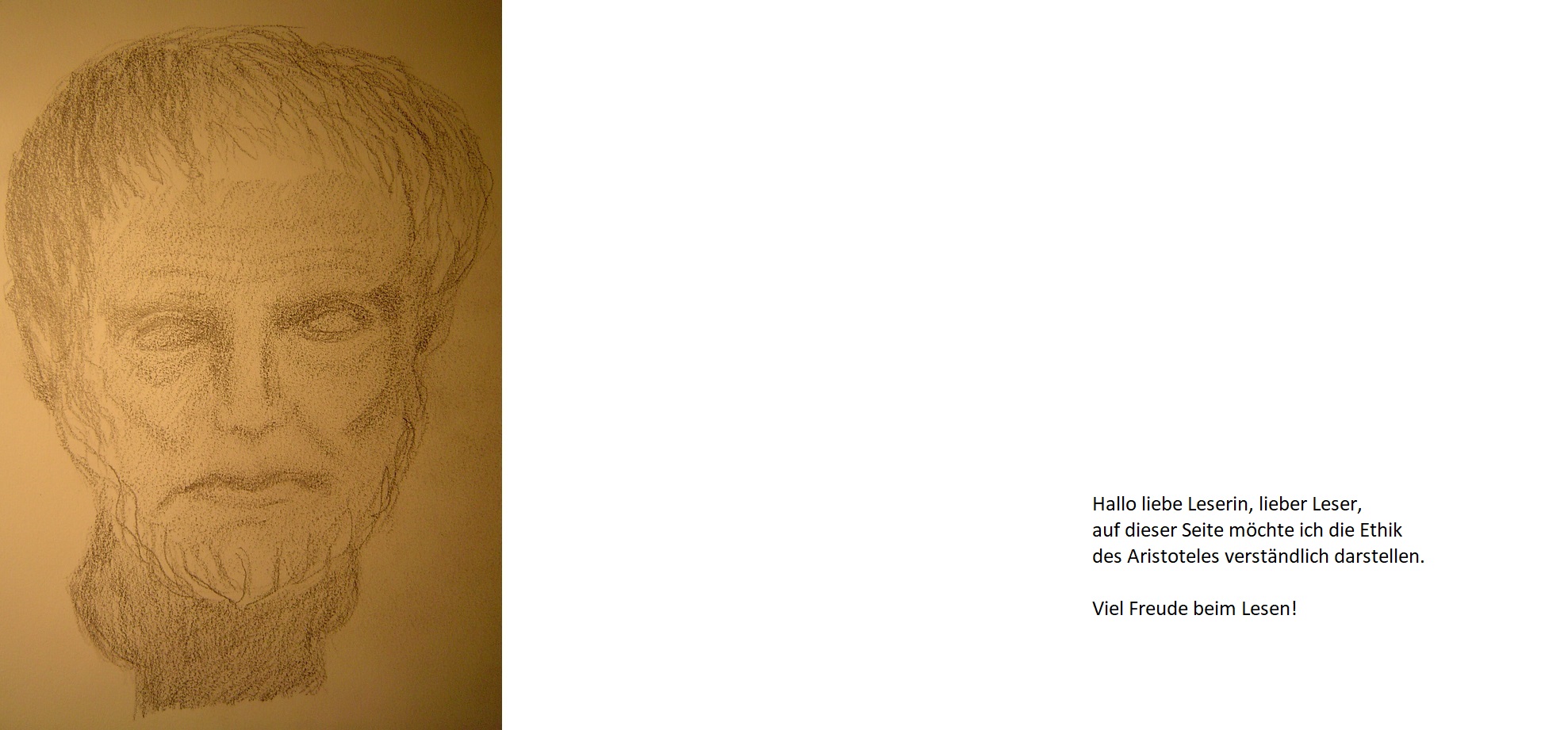Einleitung:
Buch I der Nikomachischen Ethik thematisiert im Wesentlichen das Glück, Buch II die Tugend. Die ersten Kapitel von Buch III behandeln die Freiwilligkeit als Thema; ab etwa der Mitte von Buch III und in Buch IV befasst sich Aristoteles im wesentlichen mit den charakterlichen (ethischen) Tugenden auf den verschiedenen, einzelnen Feldern, d. h. z. B. mit Tapferkeit und Mäßigkeit, aber auch mit Freigebigkeit, Stolz und Sanftmut. In Buch V thematisiert Aristoteles die Gerechtigkeit, in Buch VI die dianoetischen Tugenden bzw. Verstandestugenden wie Weisheit und Klugheit. In Buch VII behandelt er Beherrschtheit und Unbeherrschtheit sowie die Lust. In den Büchern XIII und IX thematisiert Aristoteles die Freundschaft. Im Buch X behandelt er abschließend die Lust und das Glück.
Ich wünsche dem Leser eine hoffentlich verständliche Lektüre!
Felix H.
Hauptteil:
Buch I, Kap. 1:
Aristoteles unterscheidet zwischen dem Ziel, das der Mensch um seiner selbst willen wünsche und den übrigen Dingen. Diese übrigen Dinge wünsche der Mensch sich, um mit ihrer Hilfe das Ziel, das er um seiner selbst willen wünsche, zu erreichen. Das Ziel, das der Mensch um seiner selbst willen wünsche, nennt Aristoteles das „beste Gut“.
Das beste Gut sei „Gegenstand derjenigen Disziplin […], die am meisten leitet und anordnet.“ Diese Disziplin sei die Politik. „Denn diese ordnet an, welche Kenntnisse im Staat vertreten sein müssen, welche jeder Einzelne lernen muss und bis zu welchem Grad.“
Aristoteles betont, dass das Ziel des Einzelnen und das Ziel des Staates „dasselbe“ sei. Das Ziel des Staates sei aber „größer und vollkommener“ als das Ziel des Einzelnen. „Denn erfreulich ist es zwar auch für Einen allein, schöner und göttlicher aber für ein ganzes Volk oder einen Staat.“
Buch I, Kap. 2:
Aristoteles sieht eine Übereinstimmung der Meinung der Menge und der kultivierten Menschen
darin, dass das Glück das höchste zu erreichende Gut sei. Die Menge und die kultivierten Menschen seien sich auch darin einig, dass das Glücklichsein darin liege, „dass man gut lebt und gut handelt.“
Aristoteles betont, dass seine Untersuchung sich auf diejenigen Meinungen beschränke, „die am weitesten verbreitet sind oder einigermaßen begründet scheinen.“
Buch I, Kap. 3:
Aristoteles thematisiert verschiedene Vorstellungen, was unter Glück zu verstehen ist. Die Menge meine, das Glück sei Lust. Aristoteles scheint diese Auffassung nicht zu teilen, denn er spricht in diesem Zusammenhang vom „Leben des Viehs“. Die kultivierten und aktiven Menschen meinten,
das Glück sei Ehre. Doch auch dieser Auffassung scheint Aristoteles nicht zuzustimmen. Denn er sagt, dass die Ehre „mehr von den Ehrenden als von dem Geehrtem abhängt“. Schließlich geht Aristoteles auf die Vorstellung ein, dass das Glück im Reichtum liege. Doch auch diese Auffassung
teilt Aristoteles nicht. Denn der Reichtum „ist nützlich, das heißt, er wird [nur] anderem zuliebe erstrebt.“ Neben diesen Möglichkeiten, das Glück über die Lust, die Ehre und den Reichtum zu bestimmen, zählt Aristoteles eine weitere Lebensform auf: das betrachtende Leben. Was das betrachtende Leben bedeutet und wie es zu bewerten ist, erläutert Aristoteles in diesem Kapitel jedoch nicht näher.
Buch I, Kap. 4:
Aristoteles behandelt die Vorstellung vom Guten selbst. Aristoteles lehnt die Auffassung, dass es ein Gutes selbst gebe, ab. Er begründet seine Ablehnung durch verschiedene Argumente. Zuerst weist Aristoteles darauf hin, dass der Begriff „gut“ in verschiedenen Kategorien gebraucht werde. Z. B. könne der Begriff „gut“ in der Kategorie der Substanz gebraucht werden, etwa wenn man sage, dass die Vernunft gut sei. Der Begriff „gut“ könne aber auch in der Kategorie der Zeit ausgesagt werden und dann den richtigen Zeitpunkt bezeichnen. Aristoteles weist darauf hin, dass die Substanz etwas Früheres sei als sein Akzidenz. So könne sich der Begriff „gut“ sowohl auf die frühere Substanz, als auch auf das spätere Akzidenz, z. B. einen Zeitpunkt, beziehen. Aristoteles weist auch darauf hin, dass sich mehrere Wissenschaften mit den Gütern beschäftigten. So bestimme die Strategik den richtigen Zeitpunkt im Krieg, die Medizin den richtigen Augenblick bei der Behandlung von Krankheiten. Anschließend weist Aristoteles darauf hin, dass es mehrere Dinge gebe, die „gut“ seien, wie die Ehre, das Denken und die Lust. Aristoteles betont in diesem Zusammenhang, dass Ehre, Denken und Lust aber unterschiedlich definiert würden. Schließlich gebe es das Gute selbst auch deshalb nicht, weil kein Wissenschaftler irgendeiner Wissenschaft nach dem Guten selbst suche.
Buch I, Kap. 5:
Zu Beginn des Kapitels unterscheidet Aristoteles zwischen Zielen, die „um anderer Dinge willen“ gewählt würden und abschließenden Zielen. Ein Ziel, das um anderer Dinge gewählt werde, sei
z. B. der Reichtum. Das Glück sei hingegen ein abschließendes Ziel. Denn das Glück „wählen wir immer um seiner selbst willen und niemals um anderer Dinge willen“.
Aristoteles setzt abschließende Güter mit autarken Gütern gleich: „denn das abschließende Gut gilt als autark.“ Etwas Autarkes sei „dasjenige, was auch dann, wenn man nur es allein besitzen würde, das Leben wählenswert macht“. In diesem Sinn sei das Glück etwas Autarkes.
Zum Schluss des Kapitels betont Aristoteles, dass das Glück „das wählenswerteste unter allen Dingen“ sei.
Buch I, Kap. 6:
Aristoteles fragt danach, was den Menschen kennzeichnet. Dabei unterscheidet Aristoteles drei Kriterien: Ernährung bzw. Wachstum, Wahrnehmung und Vernunft. Aristoteles stellt fest, dass Ernährung und Wachstum nicht allein dem Menschen zukämen. Denn auch die Pflanzen ernährten sich und wüchsen. Auch die Wahrnehmung komme dem Menschen nicht allein zu. Denn auch die Tiere nähmen wahr. So bliebe als Kennzeichen des Menschen allein die Vernunft übrig. Aristoteles hebt hervor, dass die Vernunft in der menschlichen Seele eine zweifache Rolle spiele. Zum einen sei die Vernunft der Teil der Seele, der denke. Zum anderen sei auch der wahrnehmende und strebende Teil der menschlichen Seele insofern vernünftig, als dass er der Vernunft folgen könne.
Buch I, Kap. 7:
Aristoteles befasst sich mit der Frage des Philosophierens über das Glück. Aristoteles möchte das Glück zunächst „skizzieren“, und erst danach sich detaillierter über das Glück äußern. Zugleich weist Aristoteles darauf hin, dass der Grad der Genauigkeit sich auch immer nach dem untersuchten Gegenstand richte. (Das bedeutet wohl im Hinblick auf das Glück, dass eine Definition des Glücks nicht so genau sein kann wie z. B. die Beschreibung eines mathematischen Sachverhalts.)
Buch I, Kap. 8:
Aristoteles betont, dass beim Philosophieren über das Glück „auch die gängigen Äußerungen darüber“ berücksichtigt werden müssten. Zu den gängigen Äußerungen über das Glück zähle auch die Meinung, dass der Glückliche gut handele und gut lebe. Aristoteles betont, dass diese Meinung
im Einklang mit seiner Definition des Glücks stehe. Denn er habe das Glück „als ein Gut-Leben und Gut-Handeln bestimmt.“
Buch I, Kap. 9:
Zu Beginn des Kapitels zitiert Aristoteles die Meinungen anderer über das Glück. So seien manche der Auffassung, dass das Glück in der Tugend liege; für andere liege es in der Klugheit, für wiederum andere in der Weisheit. Manche seien der Meinung, dass das Glück in allen diesen Dingen „oder in einem von ihnen verbunden mit Lust“ liege. Aristoteles meint, dass diese Autoren
„zumindest in einer Hinsicht oder sogar in den meisten Hinsichten Recht“ hätten.
Im weiteren Verlauf des Kapitels betont Aristoteles, dass nur derjenige, der sich über sein tugendhaftes Handeln freue, gut sei. Denn „niemand würde denjenigen gerecht nennen, der sich nicht am gerechten Handeln freut, oder den großzügig, der sich nicht an großzügigen Handlungen freut, und ebenso in den anderen Fällen.“ Aristoteles schlussfolgert, dass tugendhafte Handlungen
„als solche erfreulich“ seien. Das Glück (, das sich durch tugendhafte Handlungen einstelle,) sei dementsprechend das „Erfreulichste“.
Zum Schluss des Kapitels hebt Aristoteles aber auch die Notwendigkeit der äußeren Güter hervor,
um glücklich werden zu können. „Denn es ist unmöglich oder [zumindest] nicht leicht, werthafte Handlungen ohne Hilfsmittel zu tun.“ Denn: „Bei vielen Handlungen benutzen wir Freunde, Reichtum und politische Macht als eine Art von Werkzeugen.“
Buch I, Kap. 10:
Aristoteles hebt den Rang des Glücks als etwas Göttliches hervor. „Denn das, was der Preis und das Ziel der Tugend ist, scheint das Beste zu sein und etwas Göttliches und Seliges.“ Anschließend charakterisiert Aristoteles das Glück als „eine bestimmte Art von Tätigkeit der Seele im Sinn der Gutheit“. Er meint mit einer bestimmten „Art von Tätigkeit“ wohl die vernünftige Tätigkeit. Das Tier werde nicht glücklich genannt, da es nicht vernünftig handeln könne. Auch Kinder seien nicht glücklich. Denn sie seien „wegen ihres Alters noch nicht zu solchen [d. h. zu vernünftigen] Handlungen fähig“.
Buch I, Kap. 11:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel das Verhältnis von Glück und Wechselfällen des Schicksals. Während das Glück als etwas Dauerhaftes gelte, gelte das Schicksal als etwas, das sich häufig drehe.
Aristoteles betont, dass das tugendhafte Handeln für das Glück „verantwortlich“ sei. Aristoteles führt weiter aus, dass die Tugend eines Menschen etwas zeitlich Beständiges sei. Deshalb gehe auch der Glückliche als jemand, der stets tugendhaft handele, „am edelsten“ mit den Wechselfällen des Lebens um. Das wiederum sei der Grund, weshalb der Glückliche durch wenige Unglücksfälle nicht unglücklich werde. Durch „große und zahlreiche“ Schicksalsschläge könne aber der Glückliche schon unglücklich werden. Doch auch dann handle der Tugendhafte weiterhin tugendhaft, und könne nach „einer langen Zeitspanne“ wieder glücklich werden.
Buch I, Kap. 12:
Aristoteles behandelt die Frage, ob das Glück zu den lobenswerten oder zu den hochgeschätzten Dingen gehört. Zunächst stellt Aristoteles fest, dass der Tapfere und der Gerechte und – allgemein gesprochen – der Tugendhafte für seine Werke gelobt würden. Keiner lobe aber den Glücklichen. Der Glückliche werde vielmehr „selig“ genannt. Deshalb scheint das Glück für Aristoteles nicht zu den lobenswerten Dingen zu gehören.
Zum Schluss des Kapitels ordnet Aristoteles das Glück den „hochgeschätzten Dingen“ zu. Denn das Glück sei das „Prinzip [des Handelns]“. Denn dem Glück „zuliebe tut jeder alles Übrige“.
Buch I, Kap. 13:
Zu Beginn des Kapitels definiert Aristoteles das Glück als eine „Tätigkeit der Seele im Sinn der Gutheit“. Aristoteles fragt in diesem Kapitel nun, was unter dieser „Gutheit“ zu verstehen ist. Zunächst stellt Aristoteles fest, dass die Gutheit sich nicht auf den Körper, sondern auf die Seele beziehe. (Wohl deshalb greift Aristoteles auf sein Modell der menschlichen Seele zurück. Demnach gibt es drei Seelenteile: den vegetativen Seelenteil, den begehrenden Seelenteil und den Vernunft
besitzenden Seelenteil.) In diesem Kapitel stellt Aristoteles zunächst fest, dass der vegetative Seelenteil allen Lebewesen gemeinsam sei. Der vegetative Seelenteil sei für die Ernährung und das Wachstum der Lebewesen zuständig, und vor allem im Schlaf tätig. Im Schlaf aber seien der tugendhafte und der schlechte Mensch „am wenigsten voneinander zu unterscheiden“. Deshalb scheint der vegetative Seelenteil für die Frage der Gutheit der Seele für Aristoteles nicht relevant zu sein.
Anschließend behandelt Aristoteles den strebenden Seelenteil. Der strebende Seelenteil könne an der Vernunft teilhaben, wenn er den Anweisungen der Vernunft folge. So folge der strebende Seelenteil des Tapferen der Vernunft, und habe deshalb an der Vernunft teil.
Schließlich thematisiert Aristoteles den Seelenteil, der die Vernunft besitzt. (Statt der die Vernunft besitzende Seelenteil kann man auch der denkende Seelenteil sagen.)
Die Gutheit der menschlichen Seele bezieht sich nach Aristoteles auf den strebenden und den denkenden Seelenteil. Wenn der denkende Seelenteil in einer guten Verfassung sei, dann besitze der Mensch die „Tugenden des Denkens“. Zu diesen Tugenden des Denkens zählten die Weisheit, die Klugheit und die Verständigkeit. Wenn der strebende Seelenteil in einer guten Verfassung sei, besitze der Mensch die Tugenden des Charakters. Zu den Tugenden des Charakters zählten die Mäßigkeit und die Großzügigkeit.
Buch II, Kap. 1:
Zu Beginn des Kapitels unterscheidet Aristoteles zwei Arten der Gutheit: die „Gutheit des Denkens“ und die Gutheit des Charakters. Aristoteles thematisiert nun die Frage, wie die Gutheit des Denkens und wie die Gutheit des Charakters entsteht. Die Gutheit des Denkens entstehe „größtenteils“ durch Belehrung. Die Gutheit des Charakters entstehe aus der Gewöhnung:
Zunächst verwirft Aristoteles die Behauptung, dass die Tugend des Charakters von Natur aus entstehe. Denn wir besäßen bei „dem, was uns von Natur aus gegeben ist […] zuerst die Fähigkeit und äußern erst später die Tätigkeit“. So verfüge der Mensch z. B. erst über das Sehvermögen und
könne deshalb sehen, und erwerbe nicht über das Sehen das Sehvermögen. Die Tugenden des Charakters erwerbe der Mensch hingegen durch entsprechendes Tun: Nur dadurch, dass der Mensch tapfer handele, könne er tapfer werden; nur dadurch, dass er mäßig handele, könne er mäßig werden, und nur dadurch, dass er gerecht handele, gerecht werden.
Buch II, Kap. 2:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles im Wesentlichen mit dem Verhältnis von Charaktertugend sowie Lust und Unlust. Aristoteles vertritt die These, dass sich die Charaktertugend auf Lust und Unlust beziehe. Aristoteles begründet diese These auf mehrere Weisen. Zunächst weist Aristoteles darauf hin, dass Lust und Unlust Kennzeichen für einen tugendhaft-mittleren und für einen extremen und untugendhaften Habitus sein könnten. So freue sich der Mäßige darüber, sich der taktilen Lust enthalten zu können, während sich der Unmäßige nur „ungern“ dem taktil Lustvollen enthalte.
Die Charaktertugend beziehe sich auch deshalb auf Lust und Unlust, da die Lust den Menschen dazu verleiten könne, das Schlechte zu tun, und die Unlust den Menschen dazu bringen könne, das Gute zu unterlassen. Auch hätten es die Tugenden mit Handlungen und Affekten zu tun, Lust und Unlust begleiteten aber jeden Affekt und jede Handlung. Ferner sei derjenige Mensch schlecht, der Lust und Unlust verfolge oder meide, wie er es nicht solle. Schließlich verweist Aristoteles auf Heraklits Einschätzung, dass es schwieriger sei, mit der Lust zu „kämpfen“ als mit dem Zorn. (Aristoteles meint hier wohl den Kampf der Vernunft mit Lust bzw. Zorn.)
Buch II, Kap. 3:
Aristoteles behandelt die „Schwierigkeit“, dass man durch mäßiges Handeln mäßig wird. Denn man könne einwenden, dass derjenige, der mäßig handele bereits mäßig sei. Aristoteles betont nun, dass sich die Tugend nicht nur im Ergebnis des Handelns äußere, sondern sich vor allem auch
in der Weise ihres Zustandekommens zeige. Der Tugendhafte handele nämlich „erstens wissend, zweitens vorsätzlich – und zwar vorsätzlich um der Handlung selbst willen –, drittens aus einer festen und unveränderlichen Disposition heraus.“ Die Bedingungen, mit Vorsatz und aus einer festen Disposition zu handeln, entständen erst „durch häufiges Tun“. Mäßig sei deshalb der, der schon häufig mäßig gehandelt habe und deshalb aus einer festen Disposition der Mäßigkeit heraus mäßig handele.
Buch II, Kap. 4:
In diesem Kapitel fragt Aristoteles danach, was die Tugend ihrer Gattung nach ist. Zunächst stellt Aristoteles fest, dass die Seele aus Affekten, Anlagen und Dispositionen bestehe. Affekte seien „Gefühle, die von Lust und Unlust begleitet werden“ wie z. B. Zorn, Furcht, Mut und Neid. Anlagen seien das, was uns in die Lage versetze, Affekte zu empfinden. Eine Disposition bezeichne
die Haltung eines Menschen „den Affekten gegenüber“. Eine gute Disposition, z. B. dem Zorn gegenüber, liege darin, weder zu viel, noch zu wenig zu zürnen.
Aristoteles stellt fest, dass Tugenden keine Affekte seien. Denn „nicht aufgrund unserer Affekte werden wir gelobt oder getadelt“. So werde der Zornige nicht deshalb getadelt, weil er überhaupt Zorn empfinde. Anschließend stellt Aristoteles fest, dass die Tugenden auch keine Anlagen seien. „Denn man nennt uns nicht gut oder schlecht aufgrund der bloßen Anlage, Affekte zu erleiden“. Da es in der Seele nur Affekte, Anlagen und Dispositionen gebe und da Tugenden „weder Affekte noch Anlagen“ seien, schlussfolgert Aristoteles, dass Tugenden der Gattung nach Dispositionen seien.
Buch II, Kap. 5:
Aristoteles will die Tugend definieren. Im letzten Kapitel bestimmte er, dass die charakterliche Tugend ihrer Gattung nach eine Disposition sei. (Um die Tugend jedoch zu definieren, muss Aristoteles neben der Gattung auch die Art festlegen. Denn der Mensch, der habituell zu viel zürnt, hat auch eine Disposition dem Zorn gegenüber, aber er besitzt nicht die Tugend.)
Nach Aristoteles liegt die charakterliche Tugend in einer mittleren Disposition. Aristoteles begründet diese Festlegung auf die Mitte auf verschiedene Weisen. Zunächst stellt Aristoteles fest, dass es sinnvoll sei, weder zu viel, noch zu wenig zu essen. Aus diesem Beispiel schließt Aristoteles, dass der Kundige Übermaß und Mangel meide und das Mittlere suche.
Sodann schaut Aristoteles auf diejenigen, die Produkte entwerfen und herstellen. Die Hersteller von Produkten richteten ihre Produkte nach dem Mittleren aus. Deshalb seien gut beschaffene Produkte von der Art, dass nichts von ihnen wegzunehmen sei und dass ihnen andererseits auch nichts hinzuzufügen sei.
Schließlich begründet Aristoteles die Mitte als Charakteristikum der charakterlichen Tugend damit, dass die Tugend es „mit Affekten und Handlungen“ zu tun habe. Affekte und Handlungen könnten „Übermaß, Mangel und das Mittlere“ aufweisen. Wer zu viel oder zu wenig Furcht empfinde, empfinde nicht auf die richtige Weise. Derjenige hingegen, der angemessen Furcht empfinde, sei tugendhaft. So werde auch anhand dieses Beispiels deutlich, dass die Tugend das Mittlere, d. h. die mittlere Disposition, sei.
Buch II, Kap. 6:
Zu Beginn des Kapitels definiert Aristoteles die Tugend als die Disposition, die in der Mitte liege.
Anschließend stellt Aristoteles fest, dass die Mitte durch die Klugheit bestimmt werde. Schließlich weist Aristoteles darauf hin, dass bestimmte Handlungen, wie z. B. Ehebruch und Diebstahl, immer schlecht seien. Deshalb ließen es Ehebruch und Diebstahl nicht zu, eine Mitte zu bestimmen.
Buch II, Kap. 7:
Aristoteles nennt in diesem Kapitel zehn Bereiche, und gibt für jeden Bereich eine Mitte und zwei Extreme an. Die zehn Bereiche sind: Der Umgang des Menschen mit (1.) Gefahr, mit (2.) Lust, mit (3.) kleinen Geldbeträgen, mit (4.) großen Geldbeträgen, mit (5.) großer Ehre, mit (6.) kleinen Ehrungen, mit (7.) Zorn, mit (8.) der Wahrheit, mit (9.) Witzen und mit (10.) dem Angenehmen.
(Zu 1.) Aristoteles kennzeichnet die Tapferkeit als die Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. (Zu 2.) Die Mäßigkeit sei die Mitte zwischen der Unmäßigkeit und der Empfindungslosigkeit. (Zu 3.) Die Freigebigkeit sei die Mitte zwischen Verschwendung und Geiz. (Zu 4.) Im Umgang mit großen Geldbeträgen sei die Großzügigkeit die Mitte zwischen Protzerei und Kleinlichkeit. (Zu 5.)
Im Hinblick auf große Ehre sei der Stolz die Mitte zwischen Eitelkeit und Kleinmütigkeit. (Zu 6.)
Im Hinblick auf kleine Ehrungen habe der Mittlere keinen Namen. Der, der zu viel nach Ehre strebe, sei ehrgeizig; der, der zu wenig nach Ehre strebe, „ohne Ehrgeiz“. (Zu 7.) Beim Zorn sei Sanftmut die Mitte zwischen Jähzorn und Unerzürnbarkeit. (Zu 8.) Im Umgang mit der Wahrheit sei die Wahrhaftigkeit die mittlere Disposition zwischen Angeberei und geheuchelter Bescheidenheit.
(Zu 9.) Beim Machen von Witzen heiße die Mitte Gewandtheit und liege zwischen Possenreißerei und Ungehobeltheit. (Zu 10.) Der Freundliche sei im sozialen Umgang so angenehm, wie man sein solle, und habe den mittleren Habitus zwischen dem Schmeichler und dem Streitsüchtigen.
Buch II, Kap. 8:
Zu Beginn des Kapitels weist Aristoteles darauf hin, dass die mittlere, die übermäßige und die mangelhafte Disposition einander entgegengesetzt seien. Denn die extremen Dispositionen seien der mittleren Disposition und einander entgegengesetzt. Anschließend stellt Aristoteles fest, dass die Extreme zueinander in einem größeren Gegensatz ständen als zur Mitte. Denn die Extreme seien „voneinander weiter entfernt als von der Mitte“.
Schließlich macht Aristoteles darauf aufmerksam, dass manchmal die übermäßige, manchmal die mangelhafte Disposition zur mittleren Disposition in einem größeren Gegensatz stehe. Denn manchmal sei eines der beiden Extreme der mittleren Disposition „ähnlicher“. So seien Tollkühnheit und Tapferkeit einander ähnlicher als Feigheit und Tapferkeit ähnlich seien. Außerdem weise diejenige extreme Disposition einen größeren Abstand zur mittleren Disposition auf, von der mehr Menschen betroffen seien. So neigten mehr Menschen zur Unmäßigkeit als zur Empfindungslosigkeit. Deshalb stehe die Unmäßigkeit zur Mäßigkeit in einem größeren Abstand als die Empfindungslosigkeit.
Buch II, Kap. 9:
Zu Beginn des Kapitels definiert Aristoteles die Charaktertugend als eine mittlere Disposition, die zwischen zwei Lastern liege. Sodann betont Aristoteles, dass gut zu sein eine „schwierige Aufgabe“ sei, da das Finden der Mitte nicht immer leicht sei. Z. B. sei es nicht leicht, „demjenigen zu zürnen, dem man soll, und wie viel, wann, weswegen und wie man soll“.
Aristoteles gibt anschließend drei Tipps, wie die Mitte besser gefunden werden könne. Zum einen sei es sinnvoll, sich zu überlegen, welches der beiden Extreme von der Mitte weiter entfernt sei. Aristoteles empfiehlt dann, sich von dem der Mitte mehr entgegengesetzten Extrem fernzuhalten. (Als Beispiel kann man vielleicht mit Blick auf Buch II, Kapitel 8 sagen: Handle besser etwas mäßiger als etwas zu wenig mäßig, da die Unmäßigkeit in größerem Gegensatz zur Mäßigkeit steht als die Empfindungslosigkeit.) Sodann empfiehlt Aristoteles, zu bedenken, dass Lust und Unlust uns in unserem Entscheiden beeinflussten. Der Mensch müsse sich aber am meisten vor der Lust „in Acht nehmen“. (In Buch II, Kapitel 6 wies Aristoteles darauf hin, dass die Klugheit die Mitte bestimmen solle.) Schließlich macht Aristoteles darauf aufmerksam, dass derjenige, der die Mitte nur wenig verfehle, nicht getadelt werde. Derjenige aber, der die Mitte deutlich verfehle, werde getadelt. Aristoteles empfiehlt in diesem Zusammenhang wohl auf die Meinungen anderer zu hören und gegebenenfalls das eigene Verhalten zu korrigieren.
Buch III, Kap. 1:
Aristoteles stellt fest, dass nur das, was „aus dem eigenem Wollen hervorgeht“, Lob und Tadel erfahre. Ungewolltes errege hingegen Verzeihung oder Mitleid, jedenfalls aber keinen Tadel. Aus dieser unterschiedlichen Behandlung gewollter und ungewollter Handlungen schlussfolgert Aristoteles, dass jeder, der sich mit der Frage von tugendhaftem Handeln und tugendhaftem Leben auseinandersetze, „das Gewollte und das Ungewollte gegeneinander abgrenzen“ müsse.
Nach dieser Schlussfolgerung greift Aristoteles die gängige Meinung auf, was unter dem Begriff „ungewollt“ verstanden wird. Aristoteles zufolge wird „üblicherweise“ unter „ungewollt“ das Verhalten verstanden, was durch Zwang oder was „aufgrund von Unwissenheit“ geschieht. Am Schluss dieses Kapitels kommt Aristoteles zu dem Ergebnis, dass erzwungenes Verhalten widerwillig sei. Erzwungen sei das Verhalten dann, wenn „dessen Ursprung außerhalb liegt, ohne dass die gezwungene Person etwas beiträgt“.
Buch III, Kap. 2:
Zu Beginn des Kapitels stellt Aristoteles fest, dass alles, was aufgrund von Unwissenheit geschehe, nicht gewollt sei. Im Anschluss unterscheidet Aristoteles zwei Fälle: Ein Mensch könne auf Grund von Unwissenheit gehandelt haben und seine Handlung später bedauern. Ein solcher Mensch habe „gegen sein Wollen“ gehandelt. Auch der folgende Fall sei denkbar: Ein Mensch handele auf Grund von Unwissenheit und zeige später aber keinerlei Bedauern über seine Handlung. Dieser Mensch habe „ohne sein Wollen“ gehandelt.
Anschließend geht Aristoteles näher auf die Handlung gegen das Wollen ein. Der Mensch, der gegen sein Wollen gehandelt habe (, d. h. sein Handeln später bedauere), habe in Unkenntnis der „Umstände“ gehandelt. So könne jemand einen Menschen mit einem anderen verwechseln; oder: jemandem „entschlüpft“ etwas beim Reden ungewollt.
Wer gegen sein Wollen gehandelt habe, verdiene mit Recht Verzeihung oder Mitleid seiner Mitmenschen.
Buch III, Kap. 3:
Aristoteles stellt zu Beginn des Kapitels fest, dass „gegen das Wollen“ das ist, was „aufgrund von Unwissenheit“ geschehe. Er weist aber auch darauf hin, dass das, was durch „Zwang“ geschehe, ebenfalls gegen das Wollen sei. Im Anschluss definiert Aristoteles das Gewollte als das, „dessen Ursprung im Handelnden selbst liegt, wobei er die einzelnen Bedingungen kennt, unter denen die Handlung stattfindet.“
Schließlich stellt Aristoteles fest, dass Verhalten, das durch „Erregung“ oder durch „Begierde“ zustande komme, nicht gegen das Wollen sei. Denn würde man Verhalten, das durch Erregung oder Begierde zustande komme, als „gegen das Wollen“ bezeichnen, dann würde kein Tier „aus Wollen handeln“. Aristoteles scheint aber der Ansicht zu sein, dass auch Tiere gewollt handeln (können).
Buch III, Kap. 4:
In diesem Kapitel thematisiert Aristoteles den Vorsatz. Aristoteles stellt fest, dass der Vorsatz „offensichtlich etwas Gewolltes“ sei. Der Vorsatz sei aber „nicht mit dem Gewollten identisch“. Denn das Gewollte habe eine „weitere Ausdehnung“ als der Vorsatz. Aristoteles führt zwei Argumente für seine Behauptung an, dass das Gewollte mehr umfasse als der Vorsatz. Zum einen weist Aristoteles darauf hin, dass Kinder und Tiere am Gewollten teilhätten; Kinder und Tiere hätten jedoch nicht am Vorsätzlichen teil. Zum anderen seien auch Handlungen aus einer „Augenblickslaune“ gewollt, aber nicht vorsätzlich.
Am Ende des Kapitels betont Aristoteles, dass der Vorsatz mit „Überlegung und Denken“ einhergehe. (Überlegung und Denkvermögen aber sind nach Aristoteles Kennzeichen des erwachsenen Menschen.)
Buch III, Kap. 5:
In diesem Kapitel thematisiert Aristoteles das Verhältnis von Vorsatz und Überlegung. Zunächst geht Aristoteles auf die Überlegung ein. Er stellt fest, dass die Überlegung dort stattfinde, „wo unbestimmt ist, wie zu handeln ist.“ Die Überlegung habe als ihren Gegenstand nicht das Ziel. Denn ein Arzt überlege nicht, ob er heilen soll und ein Politiker überlege nicht, ob er eine gute Ordnung herstellen solle. Vielmehr beziehe sich die Überlegung auf „das, was zu den Zielen führt.“ Schließlich stellt Aristoteles fest, dass etwas Vorgenommenes „bereits bestimmt“ worden sei: „Denn man nimmt sich das vor, was man als Ergebnis der Überlegung entschieden hat.“ Aristoteles ist also wohl der Ansicht, dass der Mensch erst die geeigneten Maßnahmen überlegt, um ein Ziel zu erreichen, bevor diese Maßnahmen zu Inhalten des Vorsatzes werden.
Buch III, Kap. 6:
Zu Beginn des Kapitels stellt Aristoteles fest, dass der Wunsch sich auf ein Ziel beziehe. Aristoteles befasst sich anschließend mit der Frage, ob man sich auch das Falsche wünschen kann. Er gibt auf diese Frage eine differenzierte Antwort: Der gute Mensch beurteile „jedes Einzelne“ richtig und wisse in jeder Situation, was wahr sei. Der schlechte Mensch aber lasse sich durch die Lust täuschen. Denn die Lust erscheine den schlechten Menschen als ein Gut, obwohl die Lust in Wahrheit kein Gut sei. So bewirke die Lust bei den schlechteren und schlechten Menschen, dass sie das Angenehme und Lustvolle „als ein Gut“ suchten und die Unlust „als ein Übel“ mieden.
Buch III, Kap. 7:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles mit der Frage, ob die Tugenden und Laster eines Menschen gewollt sind oder nicht. Am Schluss des Kapitels kommt Aristoteles zu dem Ergebnis, dass die Tugenden und Laster gewollt seien. Denn der Mensch sei „Mitursache“ seiner tugendhaften und untugendhaften Dispositionen. Ein Beispiel dafür bringt Aristoteles in der Mitte des Kapitels: Aristoteles vertritt die These, dass der Unmäßige für seine Unmäßigkeit verantwortlich sei. Denn er verbringe seine Zeit „mit Trinken“. Der Unmäßige könne seine Unmäßigkeit nicht sofort abstreifen. Aber am Anfang, als der Hang zum Trinken noch klein gewesen sei, habe der Mensch die Wahl gehabt, kein Unmäßiger zu werden. Deshalb sei der Unmäßige „aus eigenem Wollen“ unmäßig. Ausgehend von diesem Beispiel kommt Aristoteles zu dem Schluss, dass die „Schlechtigkeiten der Seele“ gewollt seien.
Buch III, Kap. 8:
Aristoteles betont, dass die „Handlungen und die Dispositionen […] nicht auf die gleiche Weise aus dem Wollen“ hervorgehen. Er begründet seine These damit, dass der Mensch Handlungen „vom Anfang bis zum Ende“ in seiner Kontrolle habe, Dispositionen hingegen „nur am Anfang“. Aristoteles unterscheidet damit wohl zwischen zwei Arten von Handlungen: Handlungen, die nicht Teil einer Gewohnheit/eines Habitus sind und gewohnheitsmäßigen/habituellen Handlungen. Erste sind nach Aristoteles wohl immer kontrollierbar; die Handlungen, die aus einem Habitus entspringen, sind nach Aristoteles aber nur so lange kontrollierbar, solange der Habitus noch im Entstehen begriffen ist.
Buch III, Kap. 9:
Zu Beginn des Kapitels definiert Aristoteles die Tapferkeit als eine „Mitte in Bezug auf Furcht und Mut“. Anschließend zählt Aristoteles mehrere Übel auf, z. B. schlechten Ruf, Armut, Krankheit und Tod. Alle diese Übel würden gefürchtet. Doch beziehe sich die Tapferkeit nicht auf alle diese Übel. Denn „Armut und Krankheit darf man wohl nicht fürchten und allgemein nichts von dem, was nicht aus Schlechtigkeit kommt und nicht durch einen selbst hervorgerufen wird.“ Aristoteles meint wohl, dass Menschen, die keine Angst vor Armut und Krankheit haben, „furchtlos“, aber nicht „tapfer“ sind.
Anschließend stellt Aristoteles fest, dass der Tod „am meisten Furcht erregt“. Wohl deshalb ist der Tod nach Aristoteles der Gegenstand der Furcht. Allerdings beziehe sich die Tapferkeit nicht auf den „Tod auf See oder durch Krankheit“, sondern auf den Tod im Krieg. Denn dieser Tod sei edel, was man an den „Ehrungen, die in den Staaten und durch die Monarchen verliehen werden“, erkennen könne.
Buch III, Kap. 10:
In diesem Kapitel beschreibt Aristoteles die Charakterzüge des Tapferen, des Tollkühnen und des Feigen. Der Tapfere fürchte die Dinge, „die man soll und weswegen man soll, ferner wie und wann man soll“. Der Tapfere fürchte also durchaus die Übel, halte ihnen aber stand. Aristoteles betont, dass der Tapfere sich so verhalte, „wie die richtige Überlegung sagt“. Der Tapfere sei vor der Tat „ruhig“, bei der Tat jedoch „heftig“.
Der Tollkühne zeige „übermäßig Mut gegenüber dem Furcht Erregenden“. Aristoteles ist aber wohl der Auffassung, dass der Tollkühne seinen Mut nur nach außen demonstriere. Denn der Tollkühne gelte „auch als Prahler“ und als „jemand, der die Tapferkeit nur vorspielt.“ Am Ende des Kapitels sagt Aristoteles über den Tollkühnen, dass dieser „vor Eintritt der Gefahr voreilig und entschlossen“ sei, sich aber „in der Gefahr“ zurückziehe. – Der Feige empfinde „im Übermaß Furcht“. Der Feige habe zu wenig Mut, und sei „ohne Hoffnung“.
Buch III, Kap. 11:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles mit Phänomenen, die der Tapferkeit ähneln, jedoch nach Ansicht des Aristoteles tatsächlich keine Tapferkeit sind. Die größte Ähnlichkeit mit der Tapferkeit habe die „Tapferkeit des Staatsbürgers“. Wenn Bürger „Gefahren“ auf sich nähmen, um gesetzlichen Strafen zu entgehen oder um „Ehrungen“ zu bekommen, seien diese Handlungen Ausdruck dieser Tapferkeit des Staatsbürgers. Um welche Gefahren es sich genau handelt, beschreibt Aristoteles an dieser Stelle nicht.
Menschen, die „gezwungen von Vorgesetzten“ handeln würden, seien ebenfalls nicht tapfer. Denn man solle „tapfer sein nicht aufgrund von Zwang, sondern weil es werthaft ist.“ Auch auf einem bestimmten Feld (besonders) Erfahrene seien nicht tapfer. So seien Söldner erfahren „in Kriegsangelegenheiten“, und würden als „tapfer“ erscheinen. Aristoteles weist aber darauf hin, dass Söldner, die erkannt hätten, dass sie nicht überlegen sind, fliehen würden. Der Tapfere sei jedoch „nicht so beschaffen.“ Auch die bloß Zornigen seien nicht tapfer. Denn tapfer sei nur der, der neben dem Zorn auch aus einem „Vorsatz“ handele. Auch die Optimisten, die „viele Menschen bei vielen Gelegenheiten besiegt haben“, seien nicht tapfer. Denn sie flöhen immer dann, „wenn die Dinge für sie nicht so ausgehen, wie sie hoffen“. Schließlich seien auch die in Unwissenheit Handelnden nicht tapfer. Denn auch sie flöhen, wenn sie erkennen würden, „dass die Lage anders ist“.
Buch III, Kap. 12:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel das Denken und Empfinden des Tapferen im Krieg. Je tugendhafter und glücklicher der Tapfere sei, „umso mehr wird ihn die Aussicht auf den Tod schmerzen.“ Denn der Tapfere „wird wissentlich der größten Güter beraubt“. Deshalb empfinde der Tapfere Schmerzen. Da der Tapfere aber „das Werthafte im Krieg anstelle dieser anderen Güter“ des Lebens wähle, werde der Tapfere noch tapferer.
Buch III, Kap. 13:
Aristoteles stellt zu Beginn des Kapitels fest, dass die Mäßigkeit eine „mittlere Disposition“ sei, und dass der Gegenstand der Mäßigkeit die Lust sei. Anschließend differenziert er zwischen zwei Arten der Lust, nämlich der körperlichen Lust und der seelischen Lust. Als ein Beispiel für eine seelische Lust nennt Aristoteles die „Liebe zum Lernen.“ Aristoteles stellt fest, dass man Menschen, die mit seelischen Arten der Lust „befasst“ seien, „weder mäßig noch unmäßig“ nenne. Er kommt zu dem Schluss, dass sich die Mäßigkeit nur auf die „körperlichen Lustempfindungen“ beziehe.
Aristoteles stellt anschließend die These auf, dass sich die Mäßigkeit nicht auf „alle“ körperlichen Lustempfindungen beziehe. Denn diejenigen, die sich „an den Gegenständen des Sehens“ freuten, würden „weder besonnen noch unmäßig“ genannt; auch würden diejenigen, dich sich „übertrieben“ darüber freuten, einen Gesang zu hören, nicht als unmäßig bezeichnet. So kommt Aristoteles zu dem Schluss, dass sich die Mäßigkeit auf das „Tasten und Schmecken“ beziehe. Da die Unmäßigen, so beschreibt er es, „vom Schmecken wenig oder gar keinen Gebrauch“ machten, bezögen sich Mäßigkeit und Unmäßigkeit v. a. auf das Tasten: Unmäßige würden sich „am Genuss, der überall durch Tasten zustande kommt“, wie beim Essen und Trinken, übermäßig erfreuen.
Buch III, Kap. 14:
In diesem Kapitel beschreibt Aristoteles die Charakterzüge des Mäßigen, des Unmäßigen und desjenigen, der zu wenig Lust am Taktilen empfindet. Der Mäßige habe die „mittlere Disposition“ auf dem Feld des Taktil-Lustvollen. Aristoteles betont, dass der Mäßige die angenehmen Dinge so liebe, „wie die richtige Überlegung vorschreibt.“ D. h. wohl, dass der Mäßige die taktil-lustvollen Dinge weder zu viel, noch zu wenig begehrt.
Der Unmäßige werde von der Begierde nach den angenehmen Dingen so stark angetrieben, dass er „diese Dinge auf Kosten von allem anderen“ wähle. Der Unmäßige leide unter seiner Unmäßigkeit. Denn der Unmäßige leide, wenn er die begehrten Dinge nicht bekomme, und er leide, solange er sie begehre. Denn die Begierde sei „mit Unlust verbunden“.
Menschen, die sich weniger am Taktil-Lustvollen freuen würden, als man soll, hätten „keinen Namen erhalten“. Denn solche Menschen fänden sich kaum.
Buch III, Kap. 15:
Im letzten Kapitel von Buch III betont Aristoteles, dass die Begierden des Menschen „mäßig“ und „von geringer Zahl“ sein sollten. Außerdem dürften die Begierden „der Vernunft in keiner Hinsicht entgegenstehen“. Der begehrende Seelenteil müsse sich vielmehr „nach den Anordnungen der Vernunft“ richten. Der Mäßige begehre „die Dinge, die man begehren soll, und wie und wann man es soll“; der Mäßige folge in seiner Art zu begehren der Vernunft.
Buch IV, Kap. 1:
Aristoteles thematisiert die Freigebigkeit. Die Freigebigkeit sei die „mittlere Disposition“ auf dem Feld des Gebens und Nehmens von Vermögen. Aristoteles beschäftigt sich nun mit der Frage, ob der Freigebige es mehr mit dem Geben von Vermögen oder mit dem Nehmen von Vermögen zu tun hat. Er stellt fest, dass der Freigebige den Reichtum „am besten“ gebrauche. Der Gebrauch des Vermögens scheine „im Ausgeben“ zu bestehen, jedoch nicht im Nehmen von Vermögen. Deshalb, so schlussfolgert Aristoteles, habe es der Freigebige eher damit zu tun, „denen zu geben, denen man geben soll, als zu nehmen, von wo man nehmen soll“.
Zum Schluss des Kapitels macht Aristoteles dies nochmals deutlich: Der freigebige Mensch werde „fast am meisten geliebt.“ Denn der Freigebige sei nützlich. Die Nützlichkeit des Freigebigen liege aber „im Geben.“
Buch IV, Kap. 2:
In diesem Kapitel beschreibt Aristoteles den Freigebigen. Zunächst stellt er fest, dass der Freigebige gebe „wem er soll, wie viel man soll und wann“. Anschließend betont Aristoteles, dass der Freigebige am Geben „Freude“ habe „oder zumindest“ nicht darunter leide. Denn tugendhafte Handlungen würden „mit Freude oder ohne Bedauern, auf keinen Fall jedoch mit Bedauern getan.“ Der Freigebige gebe jedoch nicht „jedem Beliebigen“, „denn sonst hat er nichts, was er denjenigen geben kann, denen man geben soll, und wann man es soll und wo das Geben werthaft ist.“
Aristoteles betont schließlich, dass die Freigebigkeit nicht von der „Menge der Gaben“ abhänge. Entscheidend sei vielmehr die „Disposition des Gebenden“. So könne auch ein ärmerer Mensch, der weniger gibt, weil er weniger zu geben hat, freigebig sein.
Buch IV, Kap. 3:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel den Verschwender und den Geizigen. Der Verschwender gebe zu viel Geld aus, und die meisten Verschwender nähmen sich „skrupellos und von überall“ Geld. „Denn sie möchten geben, es ist ihnen aber gleichgültig, wie und aus welchen Mitteln.“
Die meisten Verschwender seien „unmäßig“, und würden ihr „Vermögen für ihre unmäßigen Beschäftigungen“ verschwenden. Nach Aristoteles ist der Verschwender heilbar. Denn der Verschwender, der jemanden habe, der sich „um ihn bemüht“, könne „durchaus zum Mittleren und Richtigen gelangen.“
Unter den Geizigen gebe es einige, die zu wenig gäben und andere, die zu viel nähmen. Zu denjenigen, die zu wenig gäben, zählt Aristoteles den Sparsüchtigen, den Kleinlichen und den Knauserigen. Zu den Geizigen, die zu viel nähmen, zählt Aristoteles den Geldverleiher, der kleine Geldsummen gegen hohe Zinsen verleihe. Der Geiz sei – im Gegensatz zur Verschwendung – „unheilbar“. Denn das Alter und jede „Unfähigkeit“ würden geizig machen.
Der Geiz sei das größere Übel als die Verschwendung.
Buch IV, Kap. 4:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles mit der Großzügigkeit. Zunächst stellt Aristoteles fest, dass die Großzügigkeit eine Tugend sei, die sich auf das Vermögen beziehe. Im Unterschied zur Freigebigkeit habe es die Großzügigkeit mit großen Ausgaben zu tun. So sei nicht derjenige großzügig, der „in kleinen oder mittleren Dingen ausgibt, wie die Situation es verdient“, sondern der, „der sich in großen Dingen so verhält.“
Aristoteles hebt hervor, dass das Werk der großzügigen Ausgabe auch wert sein müsse. Schließlich betont Aristoteles, dass der Großzügige seine „Ausgaben mit Freude und bereitwillig“ mache.
Buch IV, Kap. 5:
Aristoteles setzt die Behandlung der Großzügigkeit fort. Aristoteles stellt fest, dass die Ausgaben des Großzügigen dem Handelnden angemessen sein müssten. Deshalb könne ein „armer Mensch“ nicht großzügig sein. Auch könne ein armer Mensch nicht großzügig sein, da er nicht die Mittel habe, „aus denen er große Beträge auf angemessene Weise ausgeben kann.“
Aristoteles betont, dass der Großzügige „nicht für sich selbst spendabel“ sei, sondern „für die Gemeinschaft“ spendabel. So mache der Großzügige z. B. „Aufwendungen für die Götter – Weihgaben, Gebäude und Opfer –“ oder sorge für die „glänzende Ausstattung eines Chors“ oder finanziere „den Empfang und das Geleit auswärtiger Gäste“ oder sorge „für Geschenke und Gegengeschenke“.
Buch IV, Kap. 6:
In diesem Kapitel beschreibt Aristoteles den Charakter des Protzers und den Charakter des Kleinlichen. Der Protzer gebe „bei Anlässen für kleine Ausgaben große Beträge aus“. Z. B. gebe der Protzer ein „Gemeinschaftsessen im Stil einer Hochzeitsfeier“. Der Protzer gebe das Geld aus, um seinen Reichtum zur Schau zu stellen, und glaube, dass er wegen seines Reichtums bewundert werde.
Der Kleinliche sehe zu, „wie er am wenigsten ausgeben kann.“ Über gemachte Aufwendungen jammere er, und denke, „dass er bei allem mehr tut, als er soll.“
Buch IV, Kap. 7:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel den Stolzen, den Eitelen und den Kleinmütigen. Zunächst stellt er fest, dass stolz der sei, „wer sich selbst großer Dinge für wert hält und dies auch [wirklich] ist.“ Später stellt Aristoteles fest, dass der Begriff des Werts sich auf die „äußeren Güter“ beziehe. Das größte äußere Gut sei die Ehre. Der Stolze verhalte sich also im Hinblick auf „Ehre und Unehre“, wie man solle. Schließlich betont Aristoteles, dass der Stolze alle Tugenden besitzen müsse. Denn ein Stolzer, der schlecht wäre, würde keine Ehre verdienen. Denn die Ehre sei „der Preis der Tugend“, und werde nur den „Guten“ zugeteilt.
Eitel sei der, der sich „großer Dinge für wert hält, ihrer aber nicht wert ist“. Der Kleinmütige halte sich „kleinerer Dinge für wert“ als er tatsächlich wert sei. – Maßvoll, aber nicht stolz nennt Aristoteles den Menschen, der „kleiner Dinge wert ist und sich kleiner Dinge für wert hält“.
Buch IV, Kap. 8:
Zu Beginn des Kapitels thematisiert Aristoteles die allgemeine Überzeugung, dass Glücksgüter, wie adelige Abstammung, Macht oder Reichtum, zum Stolz beitrügen. Tatsächlich würden „solche Dinge“ manche Menschen stolzer machen, denn sie würden „dann nämlich von manchen geehrt.“
In Wahrheit, so betont Aristoteles, verdiene „allein der Gute“ Ehre. Auch würden Adelige, Reiche oder Mächtige, die untugendhaft seien, den Stolzen nur nachahmen, ohne dem Stolzen tatsächlich auch nur ähnlich zu sein.
Im weiteren Verlauf setzt Aristoteles seine Beschreibung des Stolzen fort. Kennzeichen des Stolzen sei es, dass er „um nichts oder kaum etwas bittet“, dass er bereitwillig helfe, „sich gegenüber Angesehenen und Begüterten großartig“ verhalte, während er sich „gegenüber Menschen mittlerer Stellung […] bescheiden verhält.“ Der Stolze mache langsame Bewegungen, und habe eine „tiefe Stimme“ sowie eine gesetzte Rede. „Denn der, dem Weniges wichtig ist, wird keine Eile haben, und wer nichts für groß hält, wird nicht angespannt sein“.
Buch IV, Kap. 9:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles mit dem Kleinmütigen und dem Eitlen. Der Kleinmütige, der in Wahrheit „guter Dinge wert“ sei, beraube sich „der Dinge, deren er wert ist“. Kleinmütige Menschen würden nicht für „dumm“ gehalten werden; man denke vielmehr, dass kleinmütige Menschen „zu wenig Selbstvertrauen“ besäßen.
Eitle Menschen seien „dumm“, und würden sich selbst nicht kennen. Denn sie „versuchen sich an ehrenvollen Dingen, wie wenn sie ihrer wert wären, und werden dann ihrer Unfähigkeit überführt.“ Eitle würden sich mit Kleidern und Ähnlichem „schmücken“, und seien darauf bedacht, „dass ihre Glücksgüter auch sichtbar sind“.
Dem Stolz sei die Kleinmütigkeit mehr entgegengesetzt als die Eitelkeit. Denn die Kleinmütigkeit sei schlechter als die Eitelkeit, und sie komme häufiger vor.
Buch IV, Kap. 10:
Neben dem Stolz beziehe sich auch eine andere Tugend auf die Ehre. Diese andere Tugend habe keinen eigenen Namen. Während der Stolz es mit der großen Ehre zu tun habe, habe diese namenlose Tugend mit kleinen Ehrungen zu tun.
Nicht tugendhaft seien der Ehrgeizige einerseits und der Mensch ohne Ehrgeiz andererseits. So werde der Ehrgeizige getadelt. Denn er strebe „mehr als gesollt nach Ehre“. Aber auch der Mensch ohne Ehrgeiz werde getadelt, denn er wolle „nicht einmal für Werthaftes geehrt werden“.
Aristoteles fasst also zusammen, dass Menschen „nach Ehre sowohl mehr, als man soll, als auch weniger“ streben würden. Deshalb gebe es auch ein „Streben, wie man soll.“ Dieses Streben sei diese „namenlose mittlere Disposition im Bereich der Ehre“, die gelobt werde.
Buch IV, Kap. 11:
Aristoteles befasst sich in diesem Kapitel mit dem Zürnen. Der Sanftmütige zürne „worüber man soll und wem man soll, ferner, wie, wann und wie lange man soll“. Aristoteles betont, dass der Sanftmütige „sich nicht vom Affekt fortreißen“ lasse, und so zürne „wie es die Überlegung vorschreibt“. Für seinen mittleren Habitus auf dem Feld des Zürnens werde der Sanftmütige gelobt.
Der Unerzürnbare zürne zu wenig, und werde von seinen Mitmenschen getadelt: „Denn Menschen, die nicht über die Dinge erzürnen, über die man zornig sein soll, gelten als dumm“.
Bei denjenigen, die zu viel zürnen, unterscheidet Aristoteles zwischen den Erzürnbaren und den Bitteren. Die Erzürnbaren zürnten wem und worüber man nicht solle, außerdem schneller und mehr als man solle. Da sie ihren Zorn nicht zurückhalten würden, würden sie „rasch“ aufhören zu zürnen.
Während die Erzürnbaren also nicht zu lange zürnen würden, würden genau das die Bitteren tun. Denn die Bitteren würden ihre Erregung zurückhalten, so dass ihr Druck „nicht an der Oberfläche sichtbar“ werde. Da niemand sehe, wie sehr sie unter Druck stehen, bekämen sie auch keine gute Zurede. In der Folge würden die Bitteren länger als man soll zürnen. – Die Sanftmut stehe zu Erzürnbarkeit und Bitterkeit in einem größeren Gegensatz als zur Unerzürnbarkeit. Denn das Übermaß zu zürnen komme häufiger vor.
Buch IV, Kap. 12:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel die Umgangsformen. Der Beliebtheitssüchtige lobe alles, und widerspreche „in nichts“. Der Streitsüchtige widerspreche hingegen „immer“, und kümmere sich überhaupt nicht darum, ob er jemandem unangenehm sei. Diese beiden Extreme seien tadelnswerte Dispositionen.
Wer die in der Mitte zwischen diesen liegende Disposition habe, billige und verwerfe, was man solle und wie man solle. Der Mensch dieser mittleren Disposition ziele darauf ab, den anderen nicht zu kränken, und gehe – allgemein gesprochen – mit seinen Mitmenschen um, wie man solle. –
Während man die eine extreme Disposition als Beliebtheitssucht bezeichnen könne, und die andere extreme Disposition als Streitsucht, habe die in der Mitte liegende Disposition keinen eigenen Namen erhalten.
Buch IV, Kap. 13:
Aristoteles unterscheidet in diesem Kapitel den Wahrhaftigen, den betrügerischen Angeber und den Menschen von gespielter Bescheidenheit. Der betrügerische Angeber habe das, was er vorgebe, „entweder gar nicht oder in geringerem Maß“. Dem betrügerischen Angeber gehe es mit seiner Angeberei darum, zu „Ansehen“ zu kommen. Der „Mensch von gespielter Bescheidenheit“ gelte hingegen als jemand, der das, was er habe, „geringer macht“ oder gar verleugne.
Der Wahrhaftige sei ein Mittlerer zwischen dem betrügerischen Angeber und dem Menschen von gespielter Bescheidenheit: Er mache das, was er habe, „weder größer noch kleiner“, und bekenne sich zu dem, was er sei und was er habe. So sei der Wahrhaftige ein Mensch, der immer „ganz er selbst“ sei.
Der Wahrhaftige habe also die mittlere Disposition, und sei lobenswert. Der betrügerische Angeber und der Mensch von gespielter Bescheidenheit seien hingegen „beide tadelnswert“. Der betrügerische Angeber sei jedoch tadelnswerter als der Mensch von gespielter Bescheidenheit. So sei auch dem Wahrhaftigen der betrügerischer Angeber mehr entgegengesetzt als der gespielt Bescheidene, „denn er [der betrügerische Angeber] ist der Schlechtere.“
Buch IV, Kap. 14:
Aristoteles befasst sich mit dem Scherzen, und unterscheidet hierbei den Gewandten, den Possenreißer und den Steifen. Der Possenreißer strebe „überall nach dem Lächerlichen“, und sei „mehr darauf aus, andere zum Lachen zu bringen, als angemessen zu reden“. Auch bedenke der Possenreißer zu wenig, dass er durch sein Reden den Angesprochenen verletzen könne. Der Possenreißer schone weder sich selbst, noch die anderen, wenn es ihm darum gehe, Menschen zum Lachen zu bringen. So sage der Possenreißer Dinge, die „ein kultivierter Mensch nie aussprechen würde“.
Der Steife hingegen sage nie etwas Lächerliches, und könne es nicht „ertragen“, wenn andere einen Scherz machen würden. Deshalb sei der Steife nicht in der Lage, für „Geselligkeit“ zu sorgen. Der Gewandte wisse – im Gegensatz zum Possenreißer und im Gegensatz zum Steifen – „angemessen“ zu scherzen. Aristoteles meint wohl, dass der Gewandte auch nicht spotte. Denn auch wenn der Gesetzgeber das Spotten nicht verbiete, so sei der Gewandte „sich gewissermaßen selbst Gesetz“ (und spotte nicht).
Buch IV, Kap. 15:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel die Scham. Gleich zu Beginn stellt Aristoteles die These auf, dass die Scham keine Tugend sei; die Scham sei vielmehr ein Affekt. Dass die Scham ein Affekt sei, begründet Aristoteles zum einen damit, dass die, die sich schämen würden, rot würden: diese körperliche Reaktion sei ein Hinweis darauf, dass die Scham ein Affekt sei. Zum anderen begründet Aristoteles seine These, dass die Scham keine Tugend sei, damit, dass er darauf verweist, dass der ältere Mensch, der schamhaft sei, nicht gelobt werde, „denn wir denken, dass er nichts tun sollte, worüber man Scham empfindet.“
Aristoteles betont, dass die Scham ein Affekt sei, der „nicht für jedes Alter passend“ sei. Nur für „die Jugend“ sei die Scham passend. Denn die Jugendlichen würden „nach dem Affekt“ leben und deshalb „viele Fehler“ machen. Die Scham halte die Jugendlichen dabei zurück. Jugendliche, die schamhaft seien, würden deshalb gelobt.
Buch V, Kap. 1:
Aristoteles betont in diesem Kapitel, dass die Gerechtigkeit eine Disposition sei. Er bezeichnet die Gerechtigkeit näher als „eine mittlere Disposition“, die zwischen zu bestimmenden Extremen liege. Dass für Aristoteles die Gerechtigkeit eine Disposition ist, geht auch aus den beiden folgenden Aussagen über die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit hervor. Aristoteles spricht im Hinblick auf beide Aussagen davon, dass es sich um allgemein gültige Behauptungen handele. So definierten alle die Gerechtigkeit als „diejenige Disposition […], die Menschen so beschaffen macht, dass sie das Gerechte tun […] und Gerechtes wünschen.“ Die Ungerechtigkeit bezeichne man hingegen als „diejenige Disposition, die Menschen Unrecht tun und Ungerechtes wünschen lässt.“
Buch V, Kap. 2:
Zu Beginn des Kapitels betont Aristoteles, dass die Begriffe „gerecht“ und „ungerecht“ mehrere Bedeutungen hätten. So gelte als ungerecht zum einen derjenige, der „das Gesetz verletzt“, zum anderen aber auch derjenige, der mehr haben wolle.
Im Folgenden hebt Aristoteles hervor, dass das Mehr-haben-Wollen des Ungerechten auf Güter gerichtet sei; bei diesen Gütern handele es sich um solche, „auf die sich äußeres Glück und Unglück beziehen“. Allerdings wähle der Ungerechte „nicht immer das Mehr“: vom Übel wolle er nämlich weniger.
Buch V, Kap. 3:
Zu Beginn des Kapitels wiederholt Aristoteles noch einmal seine Ansicht, dass ungerecht derjenige sei, der die Gesetze verletze; gerecht sei deshalb der, der die Gesetze beachte. Aristoteles schlussfolgert, dass alles Verhalten, das den Gesetzen entspreche, „in gewisser Weise“ gerecht sei.
Anschließend thematisiert Aristoteles das Gesetz. Das Gesetz ordne an, tapfer, mäßig und sanftmütig zu sein. Das Gesetz befehle also die Tugenden zu tun, während es die Laster verbiete. „Diese Form der Gerechtigkeit“, die in der Schulphilosophie als gesetzliche Gerechtigkeit bezeichnet wird (vgl. Bien 2019, 108‒113), meine „die vollkommene Gutheit des Charakters […] in Bezug auf den anderen Menschen“. – Gerecht im Sinne dieser Form der Gerechtigkeit sei also der Mensch, der alle Tugenden besitze und deshalb im Einklang mit dem Gesetz lebe. Denn das Gesetz schreibe ebenfalls die Tugenden vor.
Buch V, Kap. 4:
Die oben beschriebene Gerechtigkeit als die Realisierung des mittleren Habitus auf jedem Gebiet und dem Befolgen der Gesetze entspreche einer Form der Gerechtigkeit; neben dieser (gesetzlichen) Gerechtigkeit gebe es eine zweite Form der Gerechtigkeit. Nach Aristoteles handelt es sich bei dieser zweiten Form der Gerechtigkeit um eine Einzeltugend – wie der Mut oder die Mäßigkeit Einzeltugenden sind.
Wer „mehr haben will“, und z. B. Ehebruch eines finanziellen „Gewinnes“ wegen begehe, handele „aus Ungerechtigkeit“. So werde – allgemein formuliert – das Gewinn-Machen „keinem anderen Laster zugeschrieben als der Ungerechtigkeit.“ Zum Schluss des Kapitels betont Aristoteles sinngemäß, dass jemand, der unerlaubte Gewinne mache, auch nicht gerecht im Sinne der gesetzlichen Gerechtigkeit sei.
Buch V, Kap. 5:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel die Gerechtigkeit im speziellen Sinn, die in der Schulphilosophie als Teilgerechtigkeit bezeichnet wird (vgl. Bien 2019, 113‒124). Die Teilgerechtigkeit betreffe drei unterschiedliche Bereiche: zum einen beziehe sie sich auf die „Verteilung von Ehre, Geld oder anderen Gütern“ unter die Mitglieder der Staatsgemeinschaft (sog. austeilende Gerechtigkeit), zum anderen beziehe sie sich auf den „Ausgleich“ in gewollten/freiwilligen Transaktionen zwischen Menschen (sog. austauschende Gerechtigkeit) und schließlich auf den Ausgleich bei ungewollten/unfreiwilligen Transaktionen (sog. korrektive Gerechtigkeit).
Zu den gewollten Transaktionen zählt Aristoteles „zum Beispiel Kauf, Verkauf, Darlehen, Bürgschaft, Nutznießung, Deposition, Miete“; bei den Transaktionen gegen das Wollen unterscheidet er heimliche und gewaltsame. Heimliche Transaktionen gegen das Wollen seien „zum Beispiel Diebstahl, Ehebruch, Giftmischerei, Kuppelei, Verführung von Sklaven, Meuchelmord, falsches Zeugnis.“ Zu den gewaltsamen Transaktionen gegen das Wollen zählt Aristoteles „zum Beispiel Misshandlung, Freiheitsberaubung, Totschlag, Raub, Verstümmelung, Verleumdung, Beleidigung.“
Buch V, Kap. 6:
Aristoteles befasst sich in diesem Kapitel mit derjenigen Teilgerechtigkeit, die in der Schulphilosophie austeilende Gerechtigkeit genannt wird. Im Hinblick auf die Verteilung von Geldern und Ehre durch den Staat an seine Bürger fordert Aristoteles, dass Personen, die „nicht gleich“ seien, „nicht gleiche Anteile“ erhalten sollten. Denn Streitigkeiten entständen, „wenn Gleiche ungleiche Anteile […] haben und zugeteilt bekommen“ oder wenn „Ungleiche gleiche Anteile haben und zugeteilt bekommen.“
Die Verteilung von Geldern und Ehren unter die Bürger könne nur dann gerecht erfolgen, wenn sie die „Würdigkeit“ der Personen beachte. Die Würdigkeit würde jedoch von verschiedenen Gruppen unterschiedlich definiert. So sähen die Demokraten die Würdigkeit des Bürgers in seinem „Status des freien Menschen“; die Oligarchen sähen die Würdigkeit im Reichtum; „manche“ sähen die Würdigkeit in adeliger Abstammung, während die Aristokraten die Würdigkeit in der „Gutheit des Charakters“ sähen. Worin Aristoteles die Würdigkeit des Bürgers sieht, wird in diesem Kapitel nicht geklärt.
Buch V, Kap. 7:
Nach der austeilenden Gerechtigkeit (als einer Form der Teilgerechtigkeit) behandelt Aristoteles in diesem Kapitel die ausgleichende Gerechtigkeit (als der anderen Form der Teilgerechtigkeit). Aristoteles unterscheidet wiederum zwei Gebiete, auf die sich die ausgleichende Gerechtigkeit bezieht. Zum einen beziehe sich die ausgleichende Gerechtigkeit auf die gewollten Transaktionen, zum anderen auf ungewollte Transaktionen. (Die ausgleichende Gerechtigkeit bei Vorliegen von ungewollten Transaktionen, wie z. B. bei Misshandlung, wird in der Schulphilosophie korrektive Gerechtigkeit genannt (vgl. Bien 2019, 123f.).) In diesem Kapitel behandelt Aristoteles die ausgleichende Gerechtigkeit im Falle einer vorherigen ungewollten Transaktion, d. h. die korrektive Gerechtigkeit.
Aristoteles geht davon aus, dass wenn der eine jemanden verletzt, der andere verletzt wird, der Erstgenannte einen „Gewinn“ gemacht habe, der Zweite einen „Verlust“ erfahren habe. Der Richter versuche nun, „diese Teile durch einen Verlust gleich zu machen“. Deshalb nehme der Richter dem Verletzenden etwas von seinem Gewinn weg, und gebe den weggenommenen Teil dem Verletzten. Zum Schluss des Kapitels definiert Aristoteles das Gerechte „bei denjenigen Transaktionen, die gegen das eigene Wollen sind“ als „das Mittlere zwischen einer Art von Gewinn und einer Art von Verlust“ oder – anders formuliert – als „dass man nachher [, d. h. nach der Tat] das Gleiche hat wie zuvor.“
Buch V, Kap. 8:
Aristoteles wendet sich der austauschenden Gerechtigkeit zu. Diese setzt freiwillige (Tausch-)Beziehungen wie Kauf und Verkauf voraus. In diesem Kapitel erläutert Aristoteles – sehr grundsätzlich – die arbeitsteilige Gesellschaft, das Geld und die Rolle des Bedürfnisses.
Aristoteles betont, dass eine Gemeinschaft „nicht aus zwei Ärzten“ enstehe, sondern „aus einem Arzt und einem Bauern“ oder – allgemein gesprochen – „aus Menschen, die verschieden“ seien.
Zwischen diesen einander ungleichen Menschen müsse eine Gleichheit hergestellt werden, d. h. es müsse feststellbar sein, wie viele Schuhe z. B. einer bestimmten Menge an Nahrungsmitteln gleichwertig seien. Dazu müssten „alle Dinge, von denen es einen Austausch gibt, irgendwie vergleichbar sein.“ Das Geld, so Aristoteles weiter, erfülle diese Funktion. Denn es messe „etwa wie viele Schuhe einem Haus oder einer bestimmten Menge an Nahrungsmitteln gleich sind.“
Der Tausch und die Tauschgemeinschaft entständen ursächlich aber nicht durch das Geld, sondern durch das Bedürfnis der Menschen: „Denn wenn die Menschen keiner Dinge bedürften […], dann gäbe es keinen Austausch“.
Buch V, Kap. 9:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel (offenbar) die Gerechtigkeit als Teilgerechtigkeit, d. h. diejenige Gerechtigkeit, bei der es um die Verteilung (austeilende Gerechtigkeit), die Korrektur (korrigierende Gerechtigkeit) und den Austausch (austauschende Gerechtigkeit) von Gütern geht. Im Hinblick auf diese Teilgerechtigkeit (oder aristotelischer formuliert: im Hinblick auf die Gerechtigkeit als Einzeltugend) bestehe das gerechte Handeln in der Mitte „zwischen dem Unrechttun und dem Unrechtleiden. Denn das eine bedeutet, zu viel, das andere, zu wenig zu haben.“
Die Ungerechtigkeit sei hingegen immer „auf das Übermaß des Nützlichen“ und auf „den Mangel des Schädlichen“ gerichtet.
Buch V, Kap. 10:
Aristoteles behandelt in diesem Kapitel mehrere Fragen. Eine wesentliche Frage darunter ist die danach, worin der Unterschied besteht, Unrecht zu tun und ungerecht zu sein. Schon zu Beginn des Kapitels weist Aristoteles darauf hin, dass Unrecht zu tun nicht zwangsläufig bedinge, „deswegen schon ungerecht zu sein“. Ein Unrecht zu tun setze voraus, „aus eigenem Wollen“ zu handeln. Gewollt handele jemand dann, wenn er über die Umstände seiner Handlung wisse, und wenn er nicht unter Zwang handele. Aristoteles unterscheidet im weiteren Verlauf des Kapitels gewollte Handlungen, die mit Vorsatz begangen werden von solchen, die „nicht mit Vorsatz“ begangen werden. Handlungen mit Vorsatz seien „diejenigen, die wir zuvor überlegt haben“; Handlungen ohne Vorsatz „die, die nicht vorher überlegt sind.“
Aristoteles sagt nun, dass jemand, der gewollt, aber ohne vorherige Überlegung, d. h. ohne Vorsatz, (etwa im Zorn oder in einem anderen natürlichen Affekt) einem anderen einen Schaden zugefügt habe, deswegen kein ungerechter Mensch sei. Denn „die Schädigung kam nicht durch Schlechtigkeit zustande.“
Wenn die Schädigung dagegen aus einem Vorsatz hervorgehe, sei der Handelnde tatsächlich ein ungerechter Mensch.
Buch V, Kap. 11:
In diesem Kapitel wirft Aristoteles die Frage auf, ob es möglich sei, „dass man mit eigenem Wollen Unrecht erleidet“. Zum Schluss des Kapitels kommt er zu dem Ergebnis, dass es nicht bei der Person liege, ungerecht behandelt zu werden. Denn „es muss jemand vorhanden sein, der Unrecht tut.“ Aristoteles schlussfolgert daraus, dass das Unrechtleiden „nicht mit eigenem Wollen“ geschehe.
Buch V, Kap. 12:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles mit der Frage, „ob derjenige Unrecht tut, der einem anderen einen größeren Betrag zugeteilt hat, als es angemessen ist, oder derjenige, der diesen größeren Betrag erhält.“ Aristoteles vertritt die Position, dass es der Verteilende sei, der Unrecht tue. Denn derjenige tue Unrecht, der „es mit Wollen tut. Dies aber findet sich dort, wo die Handlung ihren Ursprung hat“, d. h. beim Verteilenden und nicht beim Empfänger.
Buch V, Kap. 13:
Zu Beginn des Kapitels widerspricht Aristoteles gängigen Auffassungen über die Gerechtigkeit. So sei das Volk der Meinung, gerecht zu sein sei leicht. Dem sei jedoch nicht so. Auch sei die geläufige Ansicht, dass es leicht sei, zu erkennen, was gerecht und was ungerecht ist, falsch. Denn am Gesetz, so Aristoteles sinngemäß, könne man sich nicht immer orientieren, um festzustellen, was gerecht ist.
Schließlich geht Aristoteles noch einmal auf diejenige Gerechtigkeit als Teil der Tugend (oder als Einzeltugend oder als Teilgerechtigkeit bezeichnet) ein, die die Güter betrifft. Er scheint der Ansicht zu sein, dass die Güter den Göttern immer nutzen würden, während dem unheilbar schlechten Menschen die Güter sogar schaden würden. Dem normalen Menschen seien die Güter „bis zu einem bestimmten Grad“ nützlich. Deshalb sei das Gerechte „etwas, das unter [normalen] Menschen Anwendung hat.“
Buch V, Kap. 14:
Im vorletzten Kapitel von Buch V thematisiert Aristoteles die Billigkeit. Die Billigkeit sei eine „Berichtigung“ des Gesetzes. Denn das Gesetz sei „allgemein“ formuliert; richtige allgemeine Sätze ließen sich aber „über manche Dinge“ nicht aufstellen. Das Gesetz könne deshalb aufgrund seiner Allgemeinheit eine „Lücke“ aufweisen.
Wenn nun ein Fall eintrete, der vom allgemein formulierten Gesetz nicht erfasst werde, sei es richtig, das Gesetz zu „berichtigen“. Dies tue der billig eingestellte Mensch; denn er neige dazu, „nicht im schlechten Sinn zu genau am Recht“ zu kleben und dazu „weniger zu beanspruchen, obwohl er das Gesetz auf seiner Seite hat“.
Buch V, Kap. 15:
Im letzten Kapitel von Buch V behandelt Aristoteles die Frage, ob man sich selbst Unrecht tun kann. Im eigentlichen Sinn verneint Aristoteles diese Frage: Man könne sich nicht selbst Unrecht tun, denn dann müsse einer Person ein Gut „gleichzeitig weggenommen und zugeteilt werden“, was unmöglich sei. Auch sei das Unrechttun früher als das Unrechtleiden. Wenn sich jemand selbst Unrecht tun könnte, würde jemand aber „gleichzeitig“ Unrecht tun und Unrecht erleiden. Schließlich könne man sich auch deshalb nicht Unrecht tun, da niemand Ehebruch mit seiner eigenen Frau begehe oder niemand in sein eigenes Haus einbreche oder sich selbst bestehle. –
„Im übertragenen Sinn“ gebe es allerdings die Möglichkeit, sich selbst Unrecht zu tun. Aristoteles schaut in diesem Zusammenhang auf die menschliche Seele. Die Seele des Menschen bestehe nämlich (im Wesentlichen) aus einem vernünftigen und einem vernunftlosen Seelenteil. Der vernünftige Seelenteil stehe in einem „Verhältnis der Ungleichheit“ zum vernunftlosen Seelenteil. Aristoteles will damit wohl ausdrücken, dass der vernünftige Seelenteil über den vernunftlosen Seelenteil herrschen soll. Aristoteles meint wohl, dass der Mensch sich im übertragenen Sinn dann Unrecht tue, wenn er nicht dem vernünftigen Seelenteil gehorche, sondern sein Verhalten nach dem vernunftlosen Seelenteil ausrichte.
Buch VI, Kap. 1:
Zu Beginn des Kapitels betont Aristoteles – wohl mit Blick auf die ethischen Tugenden wie Tapferkeit und Mäßigkeit –, dass das Mittlere gewählt werden müsse. Anschließend sagt er, dass das Mittlere „durch die richtige Überlegung bestimmt“ werde. Aristoteles weist schließlich darauf hin, dass die richtige Überlegung nun thematisiert werden solle.
Buch VI, Kap. 2:
Zunächst unterscheidet Aristoteles zwischen den charakterlichen Tugenden und den Verstandestugenden; er verweist darauf, dass die Tugenden des Charakters bereits thematisiert worden seien, und dass nun die Tugenden des Denkens erörtert werden sollten.
Aristoteles unterteilt anschließend die menschliche Seele in zwei Bestandteile: der eine Seelenteil besitze Vernunft, der andere nicht. Inhaltlich neu in diesem Kapitel der Nikomachischen Ethik ist nun, dass Aristoteles den vernunftbegabten Seelenteil wiederum in zwei Teile differenziert. Den einen vernunftbegabten Seelenteil nennt Aristoteles den wissenschaftlichen Seelenteil; dieser Seelenteil betrachte diejenigen Dinge, die sich immer gleich verhalten würden. Der andere vernunftbegabte Seelenteil sei der überlegende Seelenteil; er betrachte das, „was [so oder] anders sein kann.“
Anschließend unterscheidet Aristoteles das betrachtende und das praktische Denken. Das betrachtende Denken ist (offenbar) rein betrachtend. Denn es ziele darauf ab, das Wahre oder Falsche zu erkennen, und sei weder „handelnd“, noch „herstellend“. Aristoteles geht auf das betrachtende Denken in diesem Kapitel nicht näher ein. Wichtiger scheint ihm das praktische Denken zu sein.
Die charakterliche Tugend äußere sich in vorsätzlichen Handlungen. Der gute Vorsatz beruhe einerseits auf dem richtigen Streben und andererseits auf einer wahren Überlegung. Der Mensch strebe nach einem Ziel; der gute Mensch strebe nach dem guten Handeln. Das praktische Denken sei das Denken, „das auf einen Zweck bezogen“ sei. Aristoteles meint damit wohl, dass das praktische Denken die Mittel wählt, die zur Erreichung des (angestrebten) Ziels notwendig sind.
Buch VI, Kap. 3:
In diesem Kapitel definiert Aristoteles die Wissenschaft. Neben der Weisheit, der Klugheit, dem Herstellungswissen und dem intuitiven Denken sei die Wissenschaft ein vernünftiger Bestandteil der Seele. Die Wissenschaft diene – wie die anderen vernünftigen Bestandteile – dem Erkennen der Wahrheit.
Die Wissenschaft gelte als „lehrbar“, ihre Gegenstände als „lernbar.“ Kennzeichen der Wissenschaft ist für Aristoteles wohl, dass in der Wissenschaft Schlussfolgerungen gezogen werden. Aristoteles unterscheidet zwischen induktiven und deduktiven Schlussfolgerungen. Induktive Schlüsse würden zur Erkenntnis des Allgemeinen führen, deduktive Schlüsse hingegen vom Allgemeinen ausgehen.
Buch VI, Kap. 4:
Nach der Wissenschaft als einem vernünftigen Bestandteil der Seele, befasst sich Aristoteles in diesem Kapitel mit dem Herstellungswissen als einem weiteren vernünftigen Bestandteil der Seele. Das Herstellungswissen beziehe sich auf das, „was [so oder] anders sein kann.“ Das, was so oder anders sein kann, sei entweder Gegenstand des Herstellens oder Gegenstand des Handelns. Aristoteles betont in diesem Kapitel aber wiederholt, dass Herstellen und Handeln „zweierlei“ seien. Nach Aristoteles ist z. B. die Baukunde „eine Art von Herstellungswissen“.
Aristoteles definiert das Herstellungswissen als eine „mit Überlegung verbundene Disposition des Herstellens“. Das Herstellungswissen habe damit zu tun, „dass man sich ausdenkt und zusieht, wie etwas von den Dingen, die sowohl sein als auch nicht sein können, entstehen könnte“. Das Herstellungswissen beziehe sich nicht „auf das, was mit Notwendigkeit ist oder entsteht“ und auch nicht „auf das, was von Natur aus entsteht“.
Buch VI, Kap. 5:
Aristoteles befasst sich in diesem Kapitel mit der Klugheit. Gleich zu Beginn des Kapitels stellt er fest, dass der kluge Mensch gut darüber nachdenken könne, „was überhaupt dem guten Leben zuträglich ist.“ Im Folgenden definiert Aristoteles die Klugheit als „eine mit Überlegung verbundene wahre Disposition des Handelns“. (Während das Herstellungswissen das Herstellen betrifft, so scheint für Aristoteles die Klugheit das Handeln zu betreffen.)
Aristoteles thematisiert im Anschluss das Verhältnis von charakterlicher Tugend und Klugheit. Zunächst stellt er in diesem Zusammenhang fest, dass die Mäßigkeit die Klugheit bewahre. Anschließend spricht er allgemeiner davon, dass Lust und Unlust des Untugendhaften „solche Urteile, die in den Bereich des Handelns gehören“ verderben würden. Zum Schluss des Kapitels hebt Aristoteles hervor, dass die Klugheit die Gutheit eines der beiden vernunftbegabten Seelenteile sei. Denn sie sei die Tugend des meinenden Seelenteils, der sich auf die Dinge beziehe, die so oder anders sein könnten.
Buch VI, Kap. 6:
Zu Beginn des Kapitels spricht Aristoteles von den „Prinzipien“, dies es „für alles Beweisbare“ und „für jede Wissenschaft“ gebe. (Was Aristoteles unter Prinzipien genau versteht, führt er an dieser Stelle nicht aus.) Aristoteles stellt nun die Frage danach, welches menschliche/seelische Vermögen die Prinzipien erfasse. Am Ende des Kapitels stellt er fest, dass es die „intuitive Vernunft“ sei, die die Prinzipien zum Gegenstand habe.
Buch VI, Kap. 7:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel die Weisheit. Zwei Arten der Weisheit unterscheidet er: Zum einen bezeichne man denjenigen als weise, der auf seinem Gebiet, etwas herzustellen, besonders gut sei. So bezeichne man z. B. einzelne Bildhauer als weise Bildhauer, die besonders gut auf ihrem Gebiet seien.
Zentraler scheint für Aristoteles aber die zweite Bedeutung von Weisheit zu sein. Dieser zweiten Bedeutung zufolge bezeichnet Weisheit das richtige Erkennen der Prinzipien und das richtige Wissen, „was aus den Prinzipien folgt“. In diesem Sinn umfasse die Weisheit also sowohl die intuitive Vernunft (, um die Prinzipien zu erkennen), als auch die Wissenschaft (, um richtig schlusszufolgern). Der Gegenstand der Weisheit seien „die am höchsten geschätzten Gegenstände“; Aristoteles meint damit wohl v. a. die Götter.
Gegen Ende des Kapitels betont Aristoteles, dass die Weisheit „immer dasselbe“ beinhalte, da „das Weiße und das Gerade […] immer dasselbe ist“. Die Klugheit beinhalte dagegen immer etwas anderes, da „für Menschen etwas anderes gesund und gut ist als für Fische“ (und wohl auch deshalb, da nicht für jeden Menschen das Gleiche empfehlenswert ist, und selbst mit Blick auf einen einzelnen Menschen nicht immer dasselbe empfehlenswert ist, sondern mal dieses, mal jenes empfehlenswert ist mit Blick auf die jeweilige Lage).
Buch VI, Kap. 8:
Aristoteles thematisiert die Weisheit nicht weiter; er kommt vielmehr auf die Klugheit zurück zu sprechen und unterscheidet drei Arten von Klugheit. Die eine Art von Klugheit finde sich bei der Leitung des Hauses, eine zweite Art von Klugheit beinhalte die Gesetzgebung und die dritte Art von Klugheit bezeichnet Aristoteles als politisches Wissen. Das politische Wissen unterscheide sich in eine überlegende Art und in eine richterliche Art. (Was unter ‚überlegender Art‘ zu verstehen ist, führt Aristoteles nicht näher aus.) Insgesamt scheint Aristoteles in diesem Kapitel die Klugheit nicht nur als eine Eigenschaft in einem persönlichen/privaten Kontext zu verstehen, sondern unter Klugheit auch die (politische) Klugheit des Gesetzgebers und des Richters zu verstehen.
Buch VI, Kap. 9:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel das Verhältnis von Klugheit und Lebensalter. Nach verbreiteter Meinung könnten junge Menschen als „Geometer und Mathematiker“ weise werden, aber nicht klug sein. Aristoteles scheint diese Auffassung zu teilen. Denn er begründet sie damit, dass sich die Klugheit „auch auf das Einzelne [beziehe], womit man durch Erfahrung vertraut wird.“ Der junge Mensch, so führt Aristoteles weiter aus, sei aber „nicht erfahren“, sondern nur der Ältere.
Buch VI, Kap. 10:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles mit der Wohlberatenheit. Zunächst stellt Aristoteles fest, dass die Wohlberatenheit die „Richtigkeit des Denkens“ bezeichne. Sodann betont er, dass die Wohlberatenheit „als etwas Gute“ gelte, denn sie lasse „uns etwas Gutes erreichen“. Gegen Ende des Kapitels macht Aristoteles klar, dass sich die Wohlberatenheit auf die Mittel beziehe, die gewählt werden (müssen), um ein Ziel zu erreichen. In diesem Sinn unterscheidet er zwischen einer „Wohlberatenheit überhaupt“ und einer bestimmten Wohlberatenheit. Die Wohlberatenheit überhaupt „besteht demnach darin, im Hinblick auf das, was Ziel überhaupt ist, das Richtige zu treffen“; „eine bestimmte Wohlberatenheit“ bestehe „darin, das Richtige für ein bestimmtes Ziel zu treffen.“ – Die Wohlberatenheit sei ein „Kennzeichen der Klugen“.
Buch VI, Kap. 11:
In diesem Kapitel thematisiert Aristoteles die Verständigkeit. Die Verständigkeit habe „mit den Dingen, die Probleme aufwerfen und die man überlegen kann“ zu tun. Deshalb habe die Verständigkeit „dieselben Gegenstände wie die Klugheit“. Verständigkeit und Klugheit seien aber nicht dasselbe. Denn die Klugheit gebe „Anweisungen“ und sage, „was man tun soll oder nicht“, während die Verständigkeit bloß urteile.
Buch VI, Kap. 12:
In diesem vorletzten Kapitel von Buch VI mahnt Aristoteles, dass man auch unbewiesene Meinungen der Erfahrenen und der Klugen beachten müsse „wie Beweise.“ „Denn weil sie ein durch Erfahrung [geschärftes] Auge haben, sehen sie richtig.“ – Am Schluss des Kapitels betont Aristoteles, dass Weisheit und Klugheit jeweils „die Tugend eines anderen Bestandteils der Seele“ seien.
Buch VI, Kap. 13:
In diesem Kapitel thematisiert Aristoteles im Wesentlichen das Verhältnis von ethischer und dianoetischer Tugend. Der (dianoetisch) Kluge müsse charakterlich/ethisch gut sein. Denn klug sei nur der, der ein gutes Ziel verfolge. Der Schlechte täusche sich aber in seinen Zielsetzungen. Deshalb sei derjenige, der geschickt ein ethisch schlechtes Ziel verfolge, verschlagen, jedoch nicht klug.
Umgekehrt setze auch die charakterliche/ethische Tugend die (dianoethische Tugend der) Klugheit voraus. Hierzu holt Aristoteles etwas weiter aus und thematisiert die Entwicklung der Tugend in den verschiedenen Lebensaltern des Menschen. Das Kind sei nämlich natürlich tugendhaft. Denn wir seien „gerecht, mäßig, tapfer usw. sofort von Geburt an“. Diese natürliche Tugend sei „ohne Denken“; da sie ohne Denken sei, sei sie auch recht riskant. Erst wenn der Mensch „das Denken erwirbt“, lege er seine natürliche Tugend ab und könne tugendhaft „im eigentlichen Sinn“ werden. Weil die charakterlichen/ethischen Tugenden im eigentlichen Sinn mit dem Denken „verbunden“ seien, setze die Tugend im eigentlichen Sinn die (dianoetische) Klugheit voraus.
Buch VII, Kap. 1:
Zu Beginn von Buch VII unterscheidet Aristoteles drei „Arten von Verfassungen“, die zu meiden seien. Zu meiden seien nämlich die Schlechtigkeit, die tierische Rohheit und die Unbeherrschtheit.
Aristoteles führt anschließend aus, dass der Schlechtigkeit die charakterliche Gutheit entgegengesetzt sei; der tierischen Rohheit sei die übermenschliche Tugend „am ehesten“ entgegengesetzt, und das Gegenteil zur Unbeherrschtheit sei die Beherrschtheit. Am Ende des Kapitels macht Aristoteles klar, dass er im Folgenden wesentlich über Beherrschtheit und Unbeherrschtheit sprechen will.
Buch VII, Kap. 2:
Aristoteles bringt eine Übersicht über verschiedene, teils gegensätzliche Auffassungen über Beherrschtheit und Unbeherrschtheit. So sei z. B. im allgemeinen Sprachgebrauch umstritten, ob Unbeherrschtheit und Unmäßigkeit dasselbe bezeichne oder nicht. –
Aristoteles selbst charakterisiert den Unbeherrschten als denjenigen, der „weiß, dass es schlecht ist, was er tut“ und „es dennoch aufgrund des Affekts“ tue. Der Beherrschte hingegen wisse, dass seine „Begierden schlecht“ seien, und folge „ihnen wegen der Überlegung nicht.“
Buch VII, Kap. 3:
In diesem Kapitel charakterisiert Aristoteles den Mäßigen. Der Mäßige habe keine übermäßigen Begierden, und er habe keine schlechten Begierden. (Der Mäßige und der Beherrschte scheinen sich also darin zu unterscheiden, dass der Mäßige keine schlechten Begierden hat, während der Beherrschte schlechte Begierden hat, ihnen aber in seinem Verhalten keinen Raum gibt.) Zum Schluss des Kapitels beschreibt Aristoteles noch einmal den Unbeherrschten; dieser handele, „obwohl er überzeugt ist, dass er es nicht tun sollte, trotzdem anders.“
Buch VII, Kap. 4:
In diesem Kapitel rückt Aristoteles den Unbeherrschten zunächst in die Nähe des Unmäßigen. Denn der Unbeherrschte sei „nicht mit allen Dingen befasst“, sondern befasse sich mit denjenigen Dingen, „auf die auch der Unmäßige bezogen ist“. Wahrscheinlich meint Aristoteles damit, dass der Unbeherrschte und der Unmäßige es mit der taktilen Lust zu tun haben. Schließlich betont Aristoteles den Unterschied zwischen dem Unbeherrschten und dem Unmäßigen. Der Unmäßige denke nämlich, dass man „immer das gegenwärtige Angenehme verfolgen“ solle, während der Unbeherrschte diese Haltung nicht teile, sich aber dem taktil Lustvollen trotzdem im Übermaß hingebe.
Buch VII, Kap. 5:
Zunächst unterscheidet Aristoteles zwei Bedeutungen von Wissen. So bezeichne man denjenigen als wissend, der Wissen besitze, dieses Wissen aber nicht erwäge. Andererseits bezeichne man aber auch denjenigen als wissend, der Wissen besitze und es auch erwäge.
Als Beispiele für Personen, die Wissen hätten, es aber nicht erwögen, zählt Aristoteles den Schlafenden, den Betrunkenen und den Wahnsinnigen auf. Aber auch „diejenigen, die sich in Affekten befinden“ wüssten etwas, ohne es zu bedenken. In den Affekten befinde sich auch der Unbeherrschte. Der Unbeherrschte wisse also auch etwas, das er nicht erwäge.
Für die Frage, wie die Unwissenheit „aufgelöst“ werde und wie „der Unbeherrschte wieder wissend“ werde, gebe es „keine eigene Erklärung“, sondern dies habe „dieselbe Erklärung wie für den Betrunkenen“ und den Schlafenden.
Buch VII, Kap. 6:
In diesem Kapitel beschäftigt sich Aristoteles mit der Frage, ob es eine Unbeherrschtheit im eigentlichen Sinn und eine Unbeherrschtheit im weiten Sinn gibt. Im eigentlichen Sinn sei derjenige unbeherrscht, der „mit körperlichen Genüssen zu tun“ habe und der das Übermaß des taktil Lustvollen entgegen seiner Überlegung suche; dieser werde auch unbeherrscht ohne Zusatz genannt. Beherrschtheit und Unbeherrschtheit im eigentlichen Sinn hätten also „denselben Gegenstandsbereich wie Mäßigkeit und Unmäßigkeit“, nämlich den Umgang mit dem taktil Lustvollen.
Neben der eigentlichen Unbeherrschtheit gebe es aber auch noch eine Unbeherrschtheit „der Ähnlichkeit nach“; bei dieser Unbeherrschtheit im weiten Sinne werde der Unbeherrschte mit einem Zusatz bezeichnet, z. B. unbeherrscht im Zorn oder in Bezug auf Geld, Gewinn oder Ehre zu sein.
Menschen, die im Zorn oder in Bezug auf Geld, Gewinn oder Ehre unbeherrscht seien, würden „diese Dinge gegen die in ihnen vorhandene richtige Überlegung im Übermaß“ suchen.
Buch VII, Kap. 7:
Aristoteles vergleicht in diesem Kapitel die Unbeherrschtheit im eigentlichen Sinn mit der Unbeherrschtheit im Zorn. Gleich zu Beginn des Kapitels stellt er fest, dass die Unbeherrschtheit im Zorn „weniger niedrig“ sei als die Unbeherrschtheit, die sich auf die taktile Lust bezieht.
Für diese These führt Aristoteles im Wesentlichen zwei Argumente an. Zum einen scheine der Zorn nämlich „in gewisser Weise auf die Überlegung zu hören“. „Denn die Vernunft […] hat deutlich gemacht, dass eine Beleidigung oder Geringschätzung vorliegt“, gegen die man sich nun wehren müsse. Die Begierde folge der Vernunft hingegen nicht.
Zum anderen seien unbeherrscht Zornige weniger hinterhältig und deshalb weniger ungerecht als Menschen, die unbeherrscht in Bezug auf die taktile Lust sind. Denn der Zornige sei nicht hinterhältig; sein Zorn trete vielmehr „offen zutage.“ Der die taktile Lust im Übermaß Begehrende könne hingegen (sehr) „hinterhältig“ agieren. Aristoteles nennt die Göttin Aphrodite nach Homer als ein Beispiel für Verführung.
Buch VII, Kap. 8:
In diesem Kapitel unterscheidet Aristoteles zwei Formen der Unbeherrschtheit. Bei einigen sei die Unbeherrschtheit eine „Schwäche“; diese Unbeherrschten „haben zwar überlegt, bleiben dann aber wegen des Affekts nicht bei dem, was sie überlegt haben“.
Bei anderen sei die Unbeherrschtheit eine „Voreiligkeit“, denn sie „werden, weil sie nicht überlegt haben, vom Affekt geleitet.“ Zu denjenigen, die voreilig-unbeherrscht seien, zählt Aristoteles v. a. die „reizbaren Menschen“, d. h. diejenigen, die „aufgrund ihrer Voreiligkeit […] die Überlegung“ nicht abwarten.
Am Ende des Kapitels gibt Aristoteles sogar einen Ratschlag, wie es (besser) gelingt, „nicht vom Affekt besiegt“ zu werden, d. h. wohl, wie es gelingen kann, nicht unbeherrscht im Sinne einer Schwäche zu handeln. Er beobachtet nämlich, dass manche, „wenn sie zuvor wahrgenommen und gesehen haben, was kommt, und sich selbst und die Überlegung wach gehalten haben, nicht vom Affekt besiegt“ werden.
Buch VII, Kap. 9:
In diesem Kapitel scheint Aristoteles verschiedene Gründe für die These anzuführen, dass die Unbeherrschtheit weniger schlecht ist als die Unmäßigkeit. Zum einen empfinde der Unbeherrschte Bedauern über sein Verhalten, während der Unmäßige sein übermäßiges Streben nach dem taktil Lustvollen nicht bedauere, sondern bei seinem Vorsatz bleibe. In diesem Zusammenhang spricht Aristoteles auch davon, dass der Unbeherrschte „heilbar“ sei, der Unmäßige aber nicht. Zum anderen sei die Unbeherrschtheit „kein Laster“. Denn das unbeherrschte Handeln sei „gegen den Vorsatz“, während die Handlung des Lasters (immer) „dem Vorsatz“ entspreche.
Auch sei der Unbeherrschte „leicht von etwas Besserem zu überzeugen“, der Unmäßige hingegen nicht. Schließlich sei der Unbeherrschte „besser als der Unmäßige“, da er um das „Handlungsprinzip“ wisse. Das Handlungsprinzip sei das „Worum-willen“, wie Aristoteles in diesem Kapitel sagt, oder das Glück, wie Aristoteles das „Prinzip [des Handelns]“ in Buch I, Kap. 12 beschreibt: „Denn ihm zuliebe tut jeder alles Übrige“.
Buch VII, Kap. 10:
In diesem Kapitel fragt Aristoteles, ob der Beherrschte „bei jeder beliebigen Überlegung“ oder bei der richtigen Überlegung bleibe, und umgekehrt, ob der Unbeherrschte von „jeder beliebigen Überlegung“ abweiche oder nur von der richtigen Überlegung.
In „gewissem Sinn“ bleibe der Beherrschte bei jeder beliebigen Meinung, und in gewissem Sinn weiche der Unbeherrschte von jeder beliebigen Meinung ab. Doch dies scheint nicht die tatsächliche Meinung des Aristoteles zu sein. Denn er fügt unmittelbar an diese Feststellung hinzu, dass es auch ein Bild von Beherrschtheit und Unbeherrschtheit „im eigentlichen Sinn“ gebe. Im eigentlichen Sinn bleibe der Beherrschte bei der wahren Meinung, während der Unbeherrschte von der wahren Überzeugung (durch sein Verhalten) abweiche.
Buch VII, Kap. 11:
Im letzten Kapitel, das die Beherrschtheit und Unbeherrschtheit thematisiert, geht Aristoteles auf das Verhältnis von Unbeherrschtheit und Klugheit ein. Er betont, dass der Kluge nicht unbeherrscht sei. „Denn wie gezeigt ist man gleichzeitig klug und gut im Charakter.“
Im weiteren Verlauf des Kapitels hebt Aristoteles aber hervor, dass der Geschickte unbeherrscht sein könne. Aristoteles weist deshalb noch einmal auf den Unterschied von Klugheit und Geschicklichkeit hin, wie er ihn bereits beschrieben habe. Die Geschicklichkeit stehe der Klugheit „nahe, was die Überlegung“ betreffe, sei jedoch verschieden von ihr „in Hinsicht auf den Vorsatz“.
(In Buch VI, Kap. 13 beschreibt Aristoteles die Geschicklichkeit als etwas so Geartetes, „dass es zu tun und zu erreichen vermag, was zum festgesetzten Zielpunkt führt.“ Das Ziel könne dabei sowohl gut als auch schlecht sein. Um aber klug zu sein, müsse man auch ein gutes Ziel verfolgen.)
Buch VII, Kap. 12:
Aristoteles führt in diesem Kapitel verschiedene Ansichten über die Lust an. Manche sähen in der Lust kein Gut. Vertreter dieser Position würden z. B. darauf hinweisen, dass der Kluge nicht die Lust, sondern das „Freisein von Unlust“ suche. Auch würden Anhänger dieser Auffassung darauf verweisen, dass der mäßige Mensch die Lust meide. Schließlich sei die Lust nach dieser Lesart auch deshalb kein Gut, da Lust „dem Denken hinderlich“ sei.
Andere sähen in der Lust etwas, das nur teilweise gut sei. Vertreter dieser Ansicht würden darauf verweisen, dass es auch „niedrige und tadelnswerte Arten der Lust“ gebe. Auch würden die Anhänger dieser Position darauf hinweisen, dass es „schädliche Arten“ der Lust gebe: „Denn einige angenehme Dinge machen krank.“
Eine dritte Haltung der Lust gegenüber sei diejenige anzunehmen, dass die Lust immer ein Gut sei, wenn auch nicht das beste Gut. Vertreter dieser Ansicht würden argumentieren, dass die Lust nicht das beste Gut sei, da sie „ein Werden“ sei.
Buch VII, Kap. 13:
Gleich zu Beginn des Kapitels bezieht Aristoteles Position zu den drei Ansichten über die Lust, die er im vorherigen Kapitel dargestellt hat. Die vorgebrachten Argumente ließen, so sagt Aristoteles, nicht den Schluss zu, dass die Lust kein Gut sei, und sie ließen auch nicht den Schluss zu, dass die Lust nicht das beste Gut sein könne.
Anschließend unterscheidet Aristoteles zwei Arten von Lust. Manche Dinge seien lustvoll an sich, andere seien hingegen nur akzidentell lustvoll. Akzidentell lustvoll seien „diejenigen Vorgänge, die [uns] in die natürliche Disposition versetzen“. Aristoteles denkt dabei wohl in erster Linie an das Essen als etwas akzidentell Lustvolles.
Der Mensch, dessen Natur „wiederhergestellt“ sei, freue sich „an den Dingen, die angenehm überhaupt“ seien. Dieses an sich Lustvolle sei eine „Lust ohne Unlust und Begierde“. Als ein Beispiel für eine solche Lust ohne Unlust und Begierde nennt Aristoteles die Lust am Betrachten. Er meint mit Lust ohne Unlust und Begierde wahrscheinlich, dass dem Betrachten keine Unlust und keine Begierde vorangehen, während dem Genuss an Speisen und Getränken Hunger und Durst (als Unlust und Begierde) vorangehen.
Buch VII, Kap. 14:
Im vorletzten Kapitel von Buch VII thematisiert Aristoteles das Verhältnis von Lust und Glück. Zunächst sagt er, dass die meisten Arten der Lust „schlecht“ seien. (Wahrscheinlich denkt Aristoteles dabei v. a. an die taktile Lust.) Doch direkt im Anschluss daran stellt Aristoteles fest, dass das Leben des Glücklichen „lustvoll“ sei: Alle würden „mit gutem Grund“ die Lust in das Glück einflechten. Die Lust scheint für Aristoteles der erste Bestandteil des Glücks zu sein. Weitere Bestandteile bzw. Voraussetzungen nennt Aristoteles im Anschluss. Um glücklich zu sein, bedürfe es auch der körperlichen Güter, der äußeren Güter und des glücklichen Zufalls. (Auf die körperlichen Güter, die äußeren Güter und den glücklichen Zufall geht er in diesem Kapitel nicht näher ein.)
Buch VII, Kap. 15:
Zu Beginn des Kapitels behandelt Aristoteles die Frage, warum die körperliche Lust vielen als wählenswert erscheint. U. a. verweist er darauf, dass die körperlichen (taktilen) Lüste deshalb als wählenswert erscheinen würden, da sie die Unlust „vertreiben“ würden. Nach dieser Lesart suchen Menschen die taktile Lust nicht nur deshalb, da die Lust selbst die Menschen dazu antreibt, sie zu suchen, sondern die Menschen suchen die Lust aus ihrem Erleben von (großer) Unlust. Wenn Menschen aus ihrer Unlust heraus die taktile Lust suchen würden, könnten sie dadurch „unmäßig“ werden. –
Im weiteren Verlauf thematisiert Aristoteles das Verhältnis von Lust und der Natur des Menschen. Für den Menschen sei nämlich nie „ein und dasselbe“ immer lustvoll. Vielmehr sei nach den Worten des Dichters die Veränderung „das Angenehmste von allem“. Der Grund dafür, dass die Veränderung als lustvoll erlebt werde, liege darin, dass die Natur des Menschen „nicht einfach“ sei. Denn die Tätigkeit des einen Bestandteils bedinge, dass dies für einen anderen Bestandteil der Seele „gegen die Natur“ sei. (Wahrscheinlich meint Aristoteles damit, dass der Mensch nicht dauernd denken kann. Denn irgendwann muss er etwas essen und trinken, und irgendwann braucht er auch Erholung.)
Die nicht-einfache Natur des Menschen kontrastiert Aristoteles mit der einfachen Natur der Götter. Für Gott sei „immer dieselbe Tätigkeit die lustvollste“. (Worin die Tätigkeit der Götter liegt, sagt Aristoteles in diesem Kapitel nicht.)
Buch VIII, Kap. 1:
Aristoteles befasst sich mit dem Stellenwert der Freundschaft. Die Freundschaft sei „äußerst notwendig für das Leben.“ „Denn niemand würde wählen, ohne Freunde zu leben, auch wenn er alle übrigen Güter hätte.“ Jungen Menschen helfe die Freundschaft, „Fehler zu vermeiden“, alten Menschen helfe die Freundschaft, Hilfe im Alltag bei Tätigkeiten, die schwer fallen, zu bekommen, und Menschen, die „auf dem Höhepunkt ihres Lebens stehen“ helfe die Freundschaft, „werthaft zu handeln“. Zugleich werde allgemein hin die Freundschaft als Ort der Zuflucht bei Armut und „anderen Unglücksfällen“ gesehen.
Buch VIII, Kap. 2:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles im Wesentlichen mit der Frage, „ob es nur eine Art der Freundschaft gibt oder mehrere.“ Er stellt klar, dass Gegenstand der Liebe nur das Liebenswerte sei. Liebenswert sei zum einen das, was gut sei, zum anderen das, was angenehm sei und schließlich das, was nützlich sei. –
Am Schluss des Kapitels definiert Aristoteles die Freundschaft als gegenseitiges Wohlwollen, das nicht verborgen bleibe. Die Liebe zu leblosen Dingen werde nicht als Freundschaft bezeichnet, denn man wünsche einem Gegenstand wie einem Glas Wein nichts Gutes.
Buch VIII, Kap. 3:
Zu Beginn des Kapitels unterscheidet Aristoteles zwischen der Tugendfreundschaft, der Lustfreundschaft und der Nutzenfreundschaft. Die Nutzenfreundschaft scheine am meisten „zwischen alten Menschen vorzukommen“, da alte Menschen „das Nützliche“ suchen würden. Für die jungen Menschen sei hingegen die Lustfreundschaft typisch. Denn junge Menschen würden „insbesondere das für sie Angenehme“ suchen.
Buch VIII, Kap. 4:
In diesem Kapitel befasst sich Aristoteles mit der Tugendfreundschaft. Diese sei die Freundschaft „zwischen Menschen, die gut“ sind. Aristoteles betont, dass die Tugendfreundschaft beständig sei, denn die Tugendfreundschaft bleibe solange bestehen wie die Freunde gut seien, die Gutheit aber sei etwas in der Zeit Beständiges.
Schließlich hebt Aristoteles hervor, dass die Tugendfreundschaft die Lust- und die Nutzenfreundschaft mit beinhalte, da der Tugendhafte nicht nur gut, sondern für seinen Mitmenschen auch angenehm und nützlich sei.
Buch VIII, Kap. 5:
Aristoteles charakterisiert die verschiedenen Arten der Freundschaft. Er hebt hervor, dass allein die Tugendfreundschaft vor „Verleumdung sicher“ sei, denn die Tugendfreunde würden einander vertrauen und von einander erwarten, dass der andere Freund nie Unrecht tue. In der Lustfreundschaft und in der Nutzenfreundschaft gäbe es mitunter auch Verleumdung. –
Am Ende des Kapitels betont Aristoteles, dass Lustfreunde in aller Regel einander nur Lust und keinerlei Nutzen gewähren würden; ähnlich würden Nutzenfreunde in aller Regel einander nur Nutzen gewähren und keine Lust.
Buch VIII, Kap. 6:
In diesem Kapitel betont Aristoteles, dass schlechte Menschen eine Lust- oder eine Nutzenfreundschaft eingehen könnten. Da schlechte Menschen nur Lust- oder Nutzenfreunde, jedoch keine Tugendfreunde werden könnten, könnten sie zwar Freunde werden, aber nur Freunde im akzidentellen Sinn. Gute Menschen würden im Gegensatz zu schlechten Menschen Tugendfreunde werden und seien damit „Freunde im eigentlichen Sinn“.
Buch VIII, Kap. 7:
Aristoteles charakterisiert in diesem Kapitel die drei verschiedenen Arten von Freundschaft. Über die Tugendfreundschaft sagt er, dass ein Tugendhafter nicht viele Tugendhafte als Freunde habe. Denn es sei „nicht leicht möglich, dass viele zugleich demselben Menschen sehr gefallen“ würden, und überdies „wenig vermutlich, dass viele gleichzeitig gut“ seien. Außerdem müsse der Tugendhafte den anderen Tugendhaften erst sehr genau kennenlernen, „was überaus schwierig“ sei; erst das genaue Kennenlernen ermögliche die Entstehung einer Tugendfreundschaft. Sodann charakterisiert Aristoteles auch die Lust- und die Nutzenfreundschaft näher. Die Lustfreundschaft kenne „eher das Element der Großzügigkeit“; im Gegensatz dazu sei die Nutzenfreundschaft „etwas für Krämer.“
Buch VIII, Kap. 8:
Während Aristoteles in den vorherigen Kapiteln die Freundschaft unter Gleichrangigen behandelte, thematisiert er in diesem Kapitel nun die Freundschaft unter denen, von denen einer dem anderen überlegen ist. Zu diesen Freundschaften, die auf Überlegenheit beruhen würden, zählt Aristoteles „die Freundschaft des Vaters zum Sohn“, die Freundschaft des Älteren zum Jüngeren, die Freundschaft des Manns zur Frau und die Freundschaft „eines jeden Herrschenden zum Beherrschten.“
Mit Blick auf die Freundschaften mit einem Überlegenen betont Aristoteles, dass der Bessere mehr geliebt werden müsse als er liebe.
Buch VIII, Kap. 9:
In diesem Kapitel bespricht Aristoteles die Bedingungen für das Entstehen und für das Fortbestehen von Freundschaft. Er betont, dass die Freundschaft aufhöre, wenn Freunde zu ungleich in ihrem moralischen Niveau würden. Die Freundschaft ende auch dann, wenn Freunde finanziell allzu ungleich gestellt seien. Da die Götter den Menschen „an allen Gütern überlegen“ seien, sei die Freundschaft eines Menschen zu Gott nicht möglich. Aber auch schon die Freundschaft eines gesellschaftlich niedriger Stehenden mit einem König sei aufgrund der extremen Ungleichheit nicht möglich.
Buch VIII, Kap. 10:
Freundschaft unter Menschen, die moralisch oder finanziell allzu unterschiedlich gestellt sind, scheint für Aristoteles also nicht möglich zu sein. Ist der Unterschied zwischen zwei Menschen jedoch nicht allzu extrem, scheint Freundschaft für Aristoteles möglich zu sein. In diesem Kapitel führt Aristoteles nämlich aus, dass Menschen, die arm und reich seien, sehr wohl Freunde sein könnten, genauso zwei Menschen, von denen der eine wissend, der andere unwissend sei. In der Regel seien solch unterschiedlich gesellte Menschen Nutzenfreunde: „Denn was jemand gerade nicht hat, danach strebt er, wobei er etwas anderes als Gegenleistung gibt.“
Buch VIII, Kap. 11:
In diesem Kapitel thematisiert Aristoteles das Verhältnis zwischen Freundschaft und Gerechtigkeit. Er konstatiert, dass die Ungerechtigkeit zunehme, wenn sie „gegenüber engeren Freunden ausgeübt“ werde. Denn es sei „schlimmer, einen Gefährten des Vermögens zu berauben als einen Mitbürger“, „schlimmer, einem Bruder nicht zu helfen als einem Fremden“ nicht zu helfen und es sei „schlimmer, den Vater zu schlagen als einen beliebigen anderen Menschen.“
Buch VIII, Kap. 12:
In diesem Kapitel nennt und erläutert Aristoteles zunächst die drei guten Verfassungen und ihre drei schlechten Abweichungen, und behauptet anschließend, dass sich die Verfassungen und ihre Abweichungen auch in der Familie wiederfinden. Im Königtum herrsche Einer, der auf den Nutzen der Beherrschten sehe. In der Tyrannis herrsche der Tyrann, der nur seinen eigenen Nutzen verfolge.
In der Aristokratie würden die Besten herrschen; in der Oligarchie (einige) Reiche, nicht aber die Besten. In der Timokratie würden alle Bürger gleichermaßen herrschen, wenn sie „die Bedingung der Vermögensschätzung erfüllen.“ Die Demokratie als Abweichung von der Timokratie erläutert Aristoteles in diesem Kapitel nicht näher.
Wie oben beschrieben, behauptet Aristoteles im Verlauf des Kapitels, dass man „Abbilder“ dieser Verfassungen „auch in den Hausgemeinschaften finden“ könne. So sei das Verhältnis des Vaters zu seinen Söhnen im Idealfall das eines Königs zu seinen Beherrschten, wenn der Vater auf den Nutzen der Söhne sehe. Verfolge der Vater mit Blick auf die Söhne jedoch seinen eigenen Nutzen, sei der Vater ein Tyrann.
Das Verhältnis zwischen Mann und Frau solle aristokratisch sein, insofern der Mann dort herrsche, wo er besser sei, und die Frau dort herrsche, wo sie besser als der Mann sei. Wenn die Ehefrau sehr reich sei, könne es vorkommen, dass die Frau über den Mann herrsche; dieses Verhältnis nennt Aristoteles ein oligarchisches, das er ablehnt.
Timokratisch sei das Verhältnis der Brüder untereinander. „Denn sie sind gleich, soweit sie sich nicht im Alter unterscheiden.“ Demokratische Verhältnisse fänden sich überall dort, wo es keinen Herrn gäbe oder wo der Herr schwach sei.
Buch VIII, Kap. 13:
Aristoteles beschreibt das Verhältnis von Freundschaft und den einzelnen Verfassungen. Demnach komme die Freundschaft weniger bei den „abweichenden“ Verfassungsformen vor. (Zu diesen zählt Aristoteles die Tyrannis, die Oligarchie und die Demokratie.) Am wenigsten komme die Freundschaft in der Tyrannis vor. Denn Tyrann und Beherrschter hätten nichts gemeinsam. In der Demokratie gäbe es hingegen „eher“ Freundschaften als in der Tyrannis: „Denn Bürgern, die gleich sind, ist vieles gemeinsam.“
Buch VIII, Kap. 14:
In diesem Kapitel erläutert Aristoteles die Freundschaft zwischen Verwandten. Diese habe „viele Formen“. Zunächst beschreibt Aristoteles die Freundschaft der Eltern zu ihren Kindern. Diese würden ihre Kinder lieben, da die Kinder ein „Teil“ der Eltern seien. Aber auch die Kinder würden ihre Eltern lieben, da sie wüssten, dass sie von diesen abstammen.
Auch die Geschwister würden einander lieben. Denn sie würden von denselben Eltern abstammen. Schließlich thematisiert Aristoteles die Freundschaft zwischen Mann und Frau. Diese bestehe von Natur aus. „Denn der Mensch ist von Natur aus mehr ein Paar bildendes als ein Staaten bildendes Lebewesen“.
Buch VIII, Kap. 15:
Aristoteles setzt die drei Arten von Freundschaft in ihr Verhältnis zu dem Aspekt von Streit und Beschuldigungen in der Freundschaft. In der Tugendfreundschaft gäbe es keinen Streit, da die Tugendfreunde darin wetteifern würden, Gutes zu tun. In der Lustfreundschaft komme es „kaum“ zu Vorwürfen. „Denn beide bekommen hier gleichzeitig, was sie erstreben, wenn sie sich daran freuen, ihre Zeit zusammen zu verbringen.“ Die Nutzenfreundschaft neige hingegen zu Beschuldigungen. Denn oft meine der Nutzenfreund, er habe vom anderen weniger bekommen als ihm zustehe und verlange deshalb „immer noch mehr“.
Buch VIII, Kap. 16:
Im letzten Kapitel von Buch VIII thematisiert Aristoteles die Freundschaft zwischen einem Überlegenen und einem Unterlegenen. Überlegen sei jemand, wenn er tugendhafter oder nützlicher sei als der andere. Der Überlegene könne meinen, dass ihm zustehe, in der Freundschaft „mehr zu erhalten, da einem Guten mehr zugeteilt werden sollte.“ Der Unterlege könne jedoch die „umgekehrte Meinung“ teilen und fordern, seinerseits mehr zu bekommen, da es die „Sache eines guten Freunds [sei], den Bedürftigen zu helfen.“
Aristoteles ist nun der Meinung, dass sowohl der Überlegene, als auch der Unterlege „berechtigte Ansprüche“ habe. Er schlägt als Ausweg vor, dass der Überlegene „mehr Ehre“ vom Unterlegenen erhalten solle; der Unterlegene solle umgekehrt „mehr Gewinn“ erhalten.
Buch IX, Kap. 1:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel die heterogenen Freundschaften. Heterogen seien solche Freundschaften, in denen zwei Freunde nicht dasselbe Ziel anstreben würden. Wenn z. B. der eine Freund Lust anstrebe und der andere Nutzen anstrebe, sei dies eine heterogene Freundschaft. Aristoteles fragt nun danach, wer den Preis festsetze: der, der gebe oder der, der nehme. Der Empfänger setze den Wert der Gegenleistung fest. Um den Wert der Gegenleistung nicht zu gering anzusetzen, sollte der Empfänger „die Sache nicht so hoch einschätzen, wie sie einem wert erscheint, wenn man sie schon hat, sondern wie man sie einschätzte, ehe man sie hatte.“
Buch IX, Kap. 2:
In diesem Kapitel behandelt Aristoteles die Frage, ob man „eher einem Wohltäter zum Dank eine Leistung zurückgeben [soll], als sie dem Freund zu erweisen, wenn nicht beides möglich ist?“ Aristoteles beantwortet diese Frage dadurch, dass er folgenden Grundsatz aufstellt: Man solle „In der Regel […] eher Wohltaten erwidern als den Gefährten einen Gefallen erweisen, wie man auch eher ein Darlehen dem zurückgeben soll, dem man es schuldet, als [das Geld] einem Gefährten zu geben.“ Doch dieser Grundsatz gelte nicht immer. Denn „wenn aber das [bloße] Geben auf überragende Weise werthafter oder notwendiger ist, dann muss man sich in diese Richtung entscheiden.“
Buch IX, Kap. 3:
Aristoteles wirft in diesem Kapitel die Frage auf, ob man die Freundschaft zu einem Freund, der früher einmal gut war und untugendhaft wurde noch beibehalten solle. Er stellt zunächst fest, dass dass das Schlechte nicht liebenswert sei und auch nicht geliebt werden solle. „Denn man darf nicht ein Liebhaber des Schlechten sein noch dem Schlechten ähnlich werden“. Doch solle man die Freundschaft zum schlecht gewordenen Freund auch nicht sofort beenden. Denn man müsse dem Freund wieder „zu einem guten Charakter“ verhelfen. Erst wenn man den Freund „nicht retten“ könne, sei es richtig, die Freundschaft aufzugeben.
Buch IX, Kap. 4:
In diesem Kapitel behauptet Aristoteles, dass die freundschaftlichen Einstellungen zu den Nächsten „aus den Beziehungen“ des guten Menschen zu sich selbst abgeleitet seien. Denn Freund werde der genannt, „der das, was gut ist oder gut erscheint, wünscht und tut“; außerdem wünsche der Mensch seinem Freund, „dass dieser existiert und lebt.“ Der gute Mensch tue aber auch das Gute und wünsche, „dass er selbst lebt und erhalten bleibt“.
Buch IX, Kap. 5:
In diesem Kapitel thematisiert Aristoteles das Wohlwollen. Wohlwollende seien noch keine Freunde. „Denn denjenigen, für die man Wohlwollen empfindet, wünscht man das Gute nur, würde aber nichts mit ihnen zusammen tun und sich auch nicht für sie bemühen.“ Doch aus Wohlwollen könne eine Tugendfreundschaft erwachsen, wenn das Wohlwollen „eine zeitliche Ausdehnung annimmt und zur Vertrautheit führt“. Und jeder Freundschaft sei Wohlwollen vorausgegangen.
Der, der Wohlwollen bekomme, sei ein tugendhafter Mensch. Denn Wohlwollen entstehe durch „eine gewisse Anständigkeit, wenn einer jemandem als werthaft, tapfer oder dergleichen erscheint“.
Buch IX, Kap. 6:
Aristoteles behandelt in diesem Kapitel die Eintracht. Eintracht herrsche, „wenn die Menschen über das Förderliche einer Meinung sind, sich dasselbe vornehmen und die gemeinsamen Beschlüsse durchführen.“ Zum Beispiel sei ein Staat dann „einträchtig, wenn alle Bürger denken, dass die Ämter durch Wahl vergeben werden sollen oder dass ein Bündnis mit Sparta geschlossen werden soll oder dass Pittakos Herrscher werden soll“.
Gegen Ende des Kapitels hebt Aristoteles hervor, dass die Eintracht unter den Bürgern auf deren Tugendhaftigkeit gründe. Die tugendhaften Bürger nämlich „befinden sich mit sich selbst wie auch untereinander in Eintracht“. Die untugendhaften Bürger aber „können nicht einträchtig sein, oder höchstens ein wenig“, denn sie würden „vom Nützlichen immer mehr haben“ wollen und blieben „in ihren Anstrengungen und Leistungen aber“ zurück.
Buch IX, Kap. 7:
Zu Beginn des Kapitels beschreibt Aristoteles den Umstand, dass Wohltäter oft „die Empfänger der Wohltaten mehr lieben als die Empfänger die Wohltäter“. Aristoteles versucht in diesem Kapitel nun, diesen Umstand zu erklären. Zum einen habe der Empfänger der Wohltat nur einen vorübergehenden Nutzen, und die Erinnerung an die nützlichen Dinge sei „gar nicht oder weniger“ angenehm. Der Wohltäter hingegen habe werthaft gehandelt, und die Erinnerung an die werthaften Dinge sei angenehm. Zum anderen erklärt Aristoteles den oben beschriebenen Umstand wie folgt: Alle „lieben […] das mehr, was durch Mühe entstanden ist, zum Beispiel lieben Menschen, die ihren Reichtum selbst erworben haben, diesen mehr als diejenigen, die ihn geerbt haben.“ Gutes zu erfahren sei aber mühelos, Gutes zu tun sei hingegen mühsam.
Buch IX, Kap. 8:
Aristoteles thematisiert in diesem Kapitel die Selbstliebe. Er unterscheidet dabei zwei Bedeutungen von Selbstliebe. Eine negativ gefärbte Auffassung von Selbstliebe scheint die Menge zu teilen. Denn diejenigen, die aus der Selbstliebe einen Vorwurf machen würden, „nennen Menschen selbstliebend, die sich selbst den größeren Anteil an Geld, Ehre und körperlicher Lust zuteilen. Denn nach diesen Dingen strebt die Menge und bemüht sich um sie, als wären sie die besten, und daher sind sie auch umkämpft.“ Menschen, die habgierig nach körperlicher Lust, Geld und Ehre streben würden, „überlassen sich ihren Begierden und allgemein den Affekten und dem vernunftlosen Teil der Seele.“ Aristoteles setzt dieser negativ konnotierten Bedeutung von Selbstliebe aber auch eine (eigene) positiv besetzte Bedeutung von Selbstliebe entgegen. Denn vielmehr als derjenige, der seinen Begierden, nach körperlicher Lust, Geld und Ehre zu streben, folge, müsse derjenige selbstliebend genannt werden, der mäßig nach körperlicher Lust und sich und anderen die Güter gerecht zuteile; dieser tugendhafte Mensch folge immer seinem Denken/seiner Vernunft und erwerbe „immer das Werthafte für sich“. Am Ende des Kapitels fordert Aristoteles, in der Weise des Tugendhaften selbstliebend zu sein, und nicht selbstliebend in der Weise zu sein, wie die Menge es ist.
Buch IX, Kap. 9:
Aristoteles wirft in diesem Kapitel die Frage auf, ob der Glückliche Freunde brauche oder nicht. Um diese Frage zu beantworten unterscheidet Aristoteles zwischen Nutzenfreunden, Lustfreunden und Tugendfreunden. Der Glückliche brauche keine Nutzenfreunde, denn er besitze „bereits alle Güter“. Auch brauche der Glückliche Lustfreunde nicht „oder nur wenig (denn da sein Leben angenehm ist, bedarf es nicht einer zusätzlich eingebrachten Lust).“
Der Glückliche bedürfe aber der Tugendfreunde, d. h. solcher Menschen, die tugendhaft seien. Denn der Glückliche wünsche „bevorzugt gute und eigene Handlungen zu betrachten […], so beschaffen aber die Handlungen des Guten sind, der ein Freund ist.“ Außerdem brauche der Glückliche Freunde, denen er etwas Gutes tun kann. Denn Freunden etwas Gutes zu tun sei werthafter als Fremden etwas Gutes zu tun.
Buch IX, Kap. 10:
In diesem Kapitel fragt Aristoteles danach, ob „man sich nun möglichst viele Menschen zu Freunden machen“ solle. Um diese Frage zu beantworten, unterscheidet Aristoteles zwischen Nutzenfreunden, Lustfreunden und Tugendfreunden. Der Mensch solle nicht zu viele Nutzenfreunde haben: „Denn vielen Menschen Gegenleistungen zu erbringen ist mühsam, und das Leben ist nicht lang genug, dies zu tun.“ Auch brauche der Mensch nur wenige Lustfreunde.
Doch auch die Zahl der Tugendfreunde, die ein Mensch haben soll, ist nach Aristoteles überschaubar. Denn die Menge an Freunden bestehe vielleicht „in der größten Zahl von Menschen, mit denen jemand zusammenleben könnte (denn dies schien in besonderem Maß das Merkmal der Freundschaft zu sein).“ Es sei aber nicht möglich, „mit vielen zusammenzuleben und sich unter ihnen aufzuteilen“. Außerdem sei der Mensch bestrebt so viele Freunde zu haben, „wie für das Zusammenleben genügen; denn es dürfte gar nicht möglich sein, vielen Menschen auf intensive Weise ein Freund zu sein.“
Buch IX, Kap. 11:
In diesem Kapitel beschäftigt sich Aristoteles mit der Frage, ob „man nun Freunde mehr im Glück oder im Unglück“ braucht. Gleich zu Beginn des Kapitels beantwortet er diese Frage schon: Freunde würden im Glück und im Unglück gesucht. „Denn die sich im Unglück befinden, brauchen Hilfe, und die Glück haben, brauchen Menschen, mit denen sie zusammenleben und denen sie Gutes tun können“. Außerdem fänden betrübte Menschen „Erleichterung, wenn die Freunde mit ihnen leiden.“ Ganz am Ende des Kapitels schlussfolgert Aristoteles, dass die Anwesenheit von Freunden „also in jeder Lage wählenswert“ scheine.
Buch IX, Kap. 12:
Im letzten Kapitel von Buch IX thematisiert Aristoteles die Frage, ob „für die Freunde das, was sie am meisten wählen, das Zusammenleben“ ist. Aristoteles bejaht diese Frage. Denn der Mensch wolle in dem, was jeden Menschen am meisten interessiert „zusammen mit den Freunden sein Leben zubringen. Daher trinken die einen zusammen, andere spielen zusammen Würfel, andere trainieren zusammen und jagen, oder sie treiben zusammen Philosophie, wobei sie alle ihre Tage gemeinsam gerade mit der Sache verbringen, die sie von allem im Leben am meisten lieben.“
Buch X, Kap. 1:
Aristoteles betont, dass es große Meinungsverschiedenheiten über das Thema Lust gebe. Denn manche sähen in der Lust ein Gut, andere sähen in der Lust hingegen etwas ganz und gar Schlechtes.
Buch X, Kap. 2:
Als einen Vertreter für die Meinung, dass die Lust ein Gut sei, führt Aristoteles Eudoxos an. Die Auffassung, dass die Lust kein Gut sei, lehnt Aristoteles ab. Denn nicht nur die vernunftlosen Wesen würden nach der Lust streben, sondern auch die vernunftbegabten.
Im weiteren Verlauf des Kapitels unterscheidet Aristoteles eine Form von Lust, der Unlust vorweg gehe von Lust ohne Unlust: Wer Hunger gehabt habe, freue sich an der „Auffüllung.“ Doch „ohne Unlust ist die Lust am Lernen sowie bei der sinnlichen Wahrnehmung die Lust des Geruchs, viele Hör- und Sehwahrnehmungen, außerdem Erinnerungen und Hoffnungen.“
Zum Schluss des Kapitels hebt Aristoteles hervor, dass die „tadelnswerten Arten“ der Lust nicht eigentlich Lust seien. Denn die tadelnswerte Lust sei nur für den Menschen in einer schlechten Verfassung lustvoll, nicht aber für den Menschen in einer guten Verfassung. Maßstab sei aber immer der Gesunde und nicht der Kranke. Unter einer tadelnswerten Art von Lust versteht Aristoteles beispielhaft wohl einen Reichtum, der durch Verrat zustande kam.
Buch X, Kap. 3:
In diesem Kapitel vergleicht Aristoteles die Lust mit dem Sehen. Denn die Lust sei wie das Sehen „in jedem Augenblick fertig.“ Denn die Lust werde nicht erst im Zeitablauf „fertig gestellt“.
Buch X, Kap. 4:
Aristoteles behauptet, dass diejenige Tätigkeit am meisten Lust bereitet, bei der ein gut verfasstes Wahrnehmungs- oder Denkvermögen „sich auf den besten der Gegenstände in seinem Bereich richtet.“ Er betont, dass jeder Mensch eine Vorliebe für einen bestimmten Gegenstand habe. So betätige sich der musikalische Mensch „durch das Hören im Bereich der Melodien“, während der Wissbegierige sich „durch das Denken im Bereich der Denkgegenstände“ betätige.
Zum Schluss des Kapitels hebt Aristoteles hervor, das die Lust die Tätigkeit des Sehens, des Hörens oder dergleichen „vollkommen“ mache.
Buch X, Kap. 5:
Zu Beginn des Kapitels betont Aristoteles, dass die Lust „eng mit der Tätigkeit verbunden“ sei. Die Lust intensiviere die Tätigkeit, so dass derjenige, der sich von Lust begleitet mit einer Sache befasse, diese besser beurteile und genauer bearbeite. Die einer Tätigkeit eigentümliche Unlust „zerstört die Tätigkeit, etwa wenn für jemanden das Schreiben oder das Rechnen unangenehm ist“; in der Folge schreibe der eine nicht, während der andere nicht rechne.
Weil die Tätigkeiten verschieden seien, seien auch die Arten der Lust verschieden. (Aristoteles zufolge unterscheiden sich wohl nicht nur Sehen und Hören voneinander, sondern auch das Hören einer Rede unterscheidet sich vom Hören von Gesang.)
Buch X, Kap. 6:
In diesem Kapitel vertritt Aristoteles die Meinung, dass nur der Mensch, der tugendhaft lebe, glücklich werden könne. Zunächst wiederholt Aristoteles seine Ansicht, dass nur das angenehm genannt werden könne, was dem Tugendhaften so erscheine. Für den Tugendhaften sei aber immer das angenehm, was seiner tugendhaften Disposition entspreche. –
Sodann wiederholt Aristoteles seine Auffassung, dass das Glück das Ziel des menschlichen Lebens sei. Denn wir „wählen […] alles um anderer Dinge willen, nur das Glück nicht.“
Buch X, Kap. 7:
In diesem Kapitel setzt Aristoteles seine Behandlung des Glücks fort. Zwar werde der Mensch durch ein ethisch gutes Leben glücklich, am glücklichsten sei aber das Leben desjenigen, der mit Hilfe seiner intuitiven Vernunft betrachte. Im Verlauf des Kapitels charakterisiert er diese betrachtende Tätigkeit: sie befasse sich mit den „höchsten unter den erkennbaren Dingen“, sie sei „die kontinuierlichste Tätigkeit“, denn der Mensch könne sie länger verrichten als irgendeine andere Handlung, sie habe die Weisheit als Tugend, sei am meisten autark, da sie im Gegensatz zu gerechten Handlungen nicht anderer Menschen und im Gegensatz zu mäßigen Handlungen nicht anderer Dinge bedürfe; außerdem zeichne sich die betrachtende Tätigkeit „durch ihre Ernsthaftigkeit“ aus, strebe „nach keinem weiteren Ziel außer ihr selbst“ und sei mit Muße verbunden.
Da der Betrachtende mit den oben beschriebenen Eigenschaften dem Glücklichen ähnele, müsse das größte Glück in der betrachtenden Tätigkeit liegen.
Buch X, Kap. 8:
Aristoteles bekräftigt in diesem Kapitel noch einmal, was er im letzten Kapitel schon behauptete: Das größte Glück bestehe im Denken/im Betrachten. Er begründet seine These aber im Unterschied zum vorherigen Kapitel anders, nämlich über Gott. Aristoteles geht davon aus, dass die Götter ein glückliches Leben führen würden, und dass das Leben der Götter im Betrachten bestehe. Denn tapfer, mäßig oder freigebig zu handeln sei eine menschliche Angelegenheit; es sei aber nicht Sache der Götter, Gefahren zu bestehen oder mit Gütern und Geld umzugehen. Auch das Herstellen sei eine menschliche und keine göttliche Sache. Da die Götter andererseits auch nicht schlafen würden, bleibe als einzige denkbare Tätigkeit der Götter nur das Denken/das Betrachten übrig. Wer also denke/betrachte wie die Götter, werde auch ähnlich glücklich wie die Götter.
Buch X, Kap. 9:
Der Weise pflege sein Denkvermögen am meisten und handele (aus Klugheit) tugendhaft. Der Weise werde deshalb von den Göttern „am meisten geliebt.“ Aristoteles vermutet, dass der Weise der Glücklichste sei.
Buch X, Kap. 10:
Zu Beginn des letzten Kapitels der Nikomachischen Ethik stellt Aristoteles fest, dass es eine Sache sei, zu wissen, was tugendhaft ist. Eine andere Sache sei es aber zu wissen, wie der Mensch tugendhaft werde. Dementsprechend behandelt er im letzten Kapitel die Erziehung des Menschen.
Aristoteles konstatiert, dass die Menge nicht durch Worte zum Tugendhaften zu motivieren sei. Denn die Leute aus der Menge „sind ihrer Natur nach so beschaffen, dass sie nicht der Scham, sondern der Furcht gehorchen und dass sie sich schlechter Handlungen nicht deshalb enthalten, weil diese niedrig sind, sondern weil sie Strafe nach sich ziehen.“ Anstelle von Belehrung betont Aristoteles vielmehr den hohen Stellenwert der Gewöhnung des Menschen daran, sich über das Richtige zu freuen und das Niedrige abzulehnen.
Sowohl unter dem Aspekt, dass der Mensch eher Strafen gehorche, als dem Werthaften zu folgen, als auch unter dem Aspekt der Gewöhnung, z. B. mutig und mäßig zu leben, fordert Aristoteles Gesetze, die die Erziehung der Kinder und die Beschäftigungen der Erwachsenen regeln. Die Gesetze haben nach Aristoteles noch einen entscheidenden Vorteil: Während Menschen, die uns etwas verbieten, dafür gehasst werden können, werde das Gesetz, „wenn es das Gute anordnet“ nicht gehasst.
Zum Abschluss der Nikomachischen Ethik verweist Aristoteles auf seine Ambition, ein Werk über die Staatsverfassungen zu schreiben.
Schluss:
Aristoteles bezeichnet das Glück als das höchste Gut, das der Mensch erreichen könne. Das Glück sei ein abschließendes Ziel. Denn das Glück diene keinem weiteren Ziel – im Gegensatz etwa zum Geld, das seinerseits für den Konsum ausgegeben werde. Um glücklich zu werden, müsse der Mensch sowohl über die Tugenden des Denkens, als auch über die Tugenden des Charakters verfügen.
Aristoteles thematisiert die Tugenden ausführlich in Buch II. Aristoteles setzt an der Unterscheidung von Tugenden des Denkens und Tugenden des Charakters an, und sagt, dass die Tugenden des Denkens vor allem durch Belehrung entständen, die Tugenden des Charakters hingegen durch Gewöhnung. Die Tugenden des Charakters würden sich immer in einem mittleren Habitus zeigen. So sei z. B. der Mut die mittlere Disposition zwischen Tollkühnheit als einer extremen Disposition und Feigheit als der anderen extremen Disposition. Im Hinblick auf den Erwerb der Tugenden des Charakters fällt auf, dass Aristoteles immer wieder darauf hinweist, wie wichtig das Tun in der konkreten Situation sei, also z. B. mutig zu handeln, um ein mutiger Mensch zu werden. Deshalb scheint mir die aristotelische Ethik sowohl eine Ethik des konkreten Tuns, als auch eine Ethik des habituellen Seins zu sein.
Dies wird m. E. auch in den Büchern III und IV, die die einzelnen Tugenden wie Mut und Mäßigkeit behandeln, deutlich.
Buch V behandelt die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit sei eine Einzeltugend wie der Mut oder die Mäßigkeit. Als eine Einzeltugend beziehe sich die Gerechtigkeit auf die Güter. Der Gerechte weise wie der Mutige oder der Mäßige einen mittleren Habitus auf; denn er beanspruche von den Gütern weder zu viel, noch zu wenig. Gerecht im Sinne der gesetzlichen Gerechtigkeit sei derjenige, der auf jedem Feld einen mittleren Habitus habe, und deshalb sowohl mutig, als auch mäßig, als auch freigebig und gerecht (im Sinne der Einzeltugend) sei.
In Buch VI thematisiert Aristoteles die dianoetischen Tugenden bzw. Verstandestugenden. Er differenziert die vernunftbegabte Seele in einen wissenschaftlichen und in einen überlegenden Seelenteil. Der wissenschaftliche Seelenteil habe es mit den Dingen zu tun, die sich immer gleich verhalten würden. Zu diesen Inhalten zählt Aristoteles wohl an erster Stelle die Götter, aber auch geometrische Formen wie die Gerade. Der überlegende Seelenteil befasse sich hingegen mit den Gegenständen, die sich so oder anders verhalten würden. Die Weisheit sei die Tugend des wissenschaftlichen Seelenteils, die Klugheit die Tugend des überlegenden Seelenteils.
In Buch VII charakterisiert Aristoteles den Unbeherrschten als denjenigen, dessen Überlegung befehle, nicht zu viel von dem taktil Lustvollen zu genießen, und der trotzdem das taktil Lustvolle zu viel genieße. Eine Form der Unbeherrschtheit führt Aristoteles auf die Voreiligkeit des Affekts zurück, eine andere auf die Schwäche der Überlegung. In seinen Ausführungen über die Lust in Buch VII unterscheidet Aristoteles das akzidentell Lustvolle von dem, was lustvoll an sich sei. Erstes sei von Unlust oder Begierde begleitet; der Lust am Essen geht im aristotelischen Verständnis wohl der Hunger vorweg. Letzteres sei hingegen nicht von Unlust oder Begierde begleitet. So sei die Lust am Betrachten ohne Unlust und ohne Begierde.
In Buch VIII thematisiert Aristoteles die Freundschaft. Er unterscheidet drei Arten von Freundschaft: Die Nutzenfreunde seien einander ausschließlich nützlich, die Lustfreunde seien einander ausschließlich angenehm; die Tugendfreunde seien einander nützlich und angenehm und böten einander überdies Schutz vor Verleumdung. In Buch IX hebt er hervor, dass man von den Nutzenfreunden und von den Lustfreunden nur wenige brauche. Auch die Zahl der Tugendfreunde sei überschaubar, da man nicht mit vielen zusammenleben könne. In Buch X betont Aristoteles, dass nur der tugendhafte Mensch glücklich lebe. Am glücklichsten sei das Leben des Menschen dann, wenn der Mensch denke/betrachte wie die (glücklich lebenden) Götter betrachten.
Literatur:
Aristoteles: Nikomachische Ethik, übersetzt und herausgegeben von Ursula Wolf, 5. Auflage, Reinbek 2015.
Sekundärliteratur:
Bien, Günther (2019): Gerechtigkeit bei Aristoteles (V), in: Höffe, Otfried (Hrsg.): Aristoteles – Die Nikomachische Ethik, 4. Auflage, Berlin, 105–128.