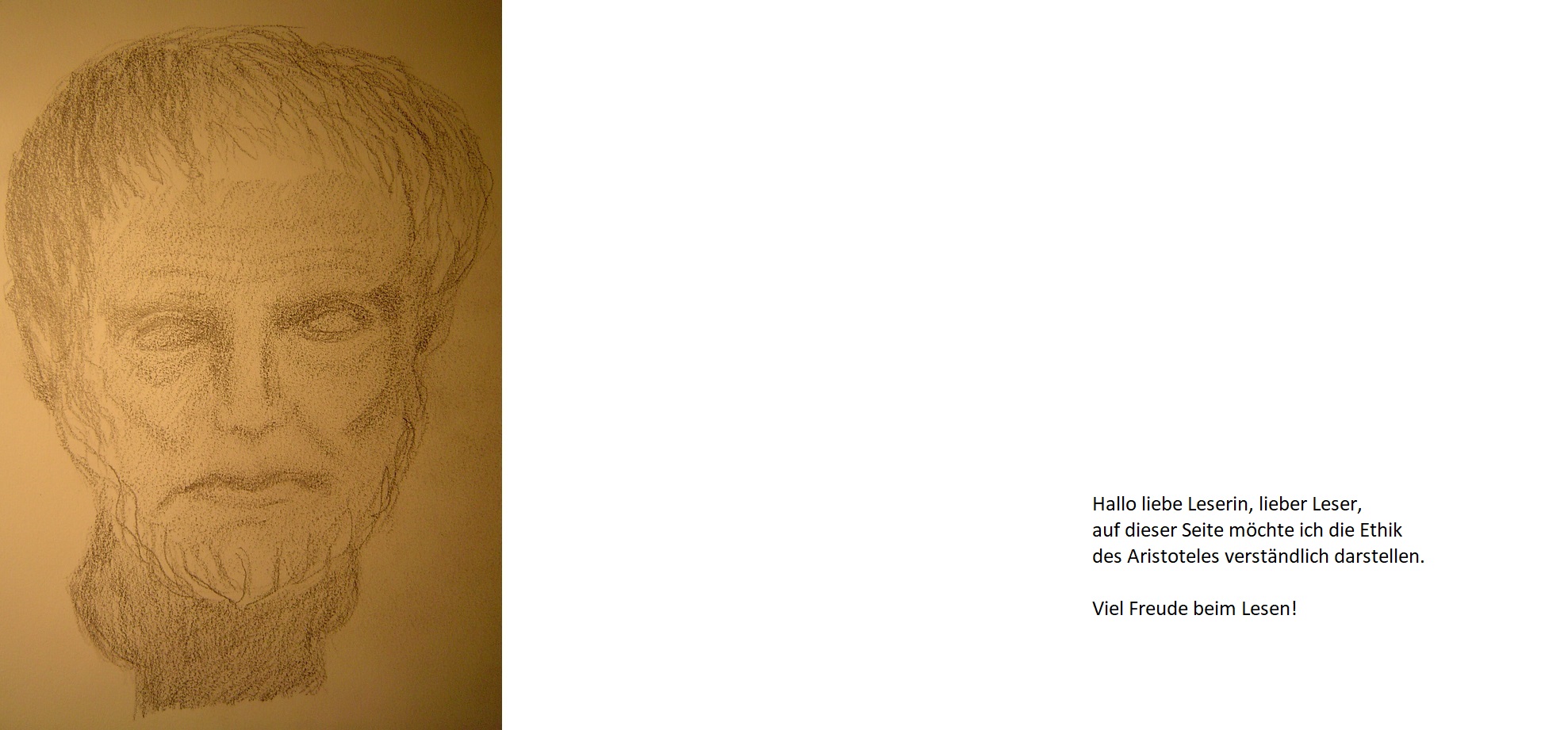Einleitung:
In der Magna Moralia thematisiert Aristoteles im Wesentlichen drei Themen: das Glück, die Tugend und die Freundschaft. Das Glück sei das höchste Gut, das der Mensch erreichen könne. Die Tugend ist für Aristoteles eine Voraussetzung, um glücklich zu werden. Um glücklich zu werden bedürfe es auch der Freundschaft. – In der Inhaltsangabe wird das Glück thematisiert, was es nach Aristoteles auszeichnet und was es voraussetzt. Sodann wird die Tugend thematisiert, wie sie unterteilt ist, was sie auszeichnet und was sie zum Gegenteil hat. Schließlich wird in der Inhaltsangabe die Freundschaft unter den Aspekten thematisiert, welche Arten von Freundschaft es gibt, welche Bedeutung die Freundschaft hat und wie hoch die Zahl der Freunde sein soll.
Ich wünsche dem Leser viel Freude beim Lesen der Zusammenfassung!
Felix H.
Hauptteil:
Buch I, Kap. 1:
Aristoteles stellt die Frage danach, was die Tugend ist. Um diese Frage zu beantworten, müsse man beachten, was andere schon früher dazu gesagt haben. Aristoteles zitiert Pythagoras, der als Erster etwas über die Tugend gesagt habe. Pythagoras habe die Tugend mit den Zahlen „in Verbindung“ gesetzt, und deshalb die Tugend auf eine Weise studiert, „die nicht organisch war.“
Als zweiten Autor zitiert Aristoteles Sokrates. Sokrates habe in den Tugenden eine Form von Erkenntnis gesehen. Aristoteles kritisiert diese Ansicht. Denn durch die Definition von Tugend als einer Form von Erkenntnis negiere Sokrates den irrationalen Seelenteil.
Schließlich zitiert Aristoteles Platon. Platon habe mit Blick auf die Seele des Menschen richtigerweise zwischen einem rationalen und einem irrationalen Seelenteil unterschieden. Aristoteles kritisiert aber an Platon, dass dieser die Tugend „mit seiner Lehre vom (obersten) Wert“ vermischt habe. (Wahrscheinlich rührt diese Kritik an Platon daher, dass Ethik und Metaphysik für Aristoteles zwei Themenfelder sind, die unabhängig nebeneinander stehen.)
Buch I, Kap. 2:
Aristoteles unterscheidet zwischen einem Vollziel und einem Teilziel. Ein Vollziel „besagt: wenn es da ist, brauchen wir nichts mehr dazu“. Das Vollziel sei das höchste Gut für den Menschen. Als Beispiel für ein Vollziel nennt Aristoteles das Glück. Das Teilziel hingegen „besagt: wenn es da ist, brauchen wir noch etwas dazu.“ Die Gerechtigkeit sei ein Teilziel.
Das Vollziel sei immer wertvoller als das Teilziel. Alle Güter, die Teilziele seien – wie z. B. Gerechtigkeit und Einsicht –, würden dabei helfen, das Vollziel, d. h. das Glück, zu erreichen.
Buch I, Kap. 3:
Aristoteles charakterisiert das Glück als das „Endziel der Güter“. Zugleich setzt Aristoteles das Glück in ein Verhältnis zur Tugend. Denn das Glück sei „gleichbedeutend“ damit, tugendhaft zu leben.
Buch I, Kap. 4:
In diesem Kapitel thematisiert Aristoteles den Zusammenhang von Tugend, rechtlichem Leben und Glück. Die „Tugend der Seele“ lasse den Menschen nämlich „rechtlich leben.“ Rechtlich zu leben bedeute „nichts anderes“ als glücklich zu sein. Am Ende des Kapitels stellt Aristoteles nochmals die Frage danach, was die Tugend sei, und stellt fest, dass sie „die wertvollste Dauerbeschaffenheit“ sei.
Buch I, Kap. 5:
Aristoteles unterscheidet den rationalen und den irrationalen Seelenteil des Menschen. Der rationale Seelenteil beinhalte Einsicht und Weisheit. Der irrationale Seelenteil zeichne sich im günstigen Fall durch Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit aus.
Im Anschluss daran lobt Aristoteles den mittleren Habitus. Denn sowohl ein „übersteigertes und durchgängiges Angstgefühl“, als auch eine „Angst vor gar nichts“ wirkten zerstörend.
Buch I, Kap. 6:
Aristoteles hebt hervor, dass die (ethische) Tugend es mit Lust und Unlust zu tun habe. Denn durch die Lust werde der Mensch dazu verleitet, das Schlechte zu tun; die Unlust hindere den Menschen hingegen daran, das Gute zu tun.
Buch I, Kap. 7:
Aristoteles beschreibt zunächst den Charakter des Aufschneiders. Der Aufschneider gebe nämlich vor, „mehr zu haben, als wirklich vorhanden ist“. Dann beschreibt Aristoteles den Charakter des geheuchelt Bescheidenen: dieser gebe vor, weniger zu haben als er tatsächlich habe. Schließlich stellt Aristoteles fest, dass die Aufrichtigkeit die „Mitte“ zwischen Aufschneiderei und geheuchelter Bescheidenheit sei. Aristoteles will damit wohl sagen, dass der Aufrichtige das, was er an Wissen und positiven Eigenschaften hat, zugibt – ohne zu übertreiben, noch zu untertreiben.
Buch I, Kap. 8:
Aristoteles unterscheidet zwei Grundhaltungen. Die eine Grundhaltung gehe auf die Mitte; diese Form von Grundhaltung sei lobenswert. Die andere Form von Grundhaltung gehe auf das Zuviel oder das Zuwenig; diese Grundhaltung sei nicht lobenswert.
Buch I, Kap. 9:
Aristoteles weist darauf hin, dass ein Extrem zur Mitte den stärkeren Gegensatz bilden könne als das andere Extrem. Dies könne zum einen aus der Sache selbst geschlossen werden. Z. B. stelle die Knauserigkeit zur Großzügigkeit den größeren Gegensatz dar als die Verschwendung. Zum anderen könne der größere Gegensatz eines Extrems zur Mitte dadurch bestimmt werden, dass man darauf sehe, wohin uns ein „natürlicher Hang“ ziehe. Deshalb stehe z. B. die Zuchtlosigkeit in einem größeren Gegensatz zur Besonnenheit als die Empfindungslosigkeit.
Buch I, Kap. 10 und 11:
Aristoteles befasst sich mit der Frage, inwiefern der Einzelne tugendhaft werden kann. Durch den Willen, tugendhaft zu werden, könne der Einzelne „an Wert zunehmen.“ Um allerdings äußerst tugendhaft zu werden, bedürfe es auch der entsprechenden Naturanlage.
Buch I, Kap. 12:
Aristoteles betont, dass der Mensch dann willentlich handele, wenn er nicht „unter Zwang“ stehe.
Buch I, Kap. 13:
Aristoteles weist darauf hin, dass man das Willentliche daran erkennen könne, dass man für gute Taten gelobt werde.
Buch I, Kap. 14:
Aristoteles thematisiert die Gewalt. Gewalt stehe außerhalb des Menschen und sei „die Ursache dafür, daß der Handelnde etwas gegen die Natur oder gegen seinen Wunsch tut“.
Buch I, Kap. 15:
Aristoteles betont, dass die Lust den Menschen zu keinem bestimmten Verhalten zwinge.
Buch I, Kap. 16:
Aristoteles definiert das Willentliche als ein Verhalten, das mit Überlegung geschehe. Das „Unwillentliche“ geschehe folglich nicht mit Überlegung, sondern z. B. „infolge von Zwang und Gewalt“.
Buch I, Kap. 17:
Aristoteles unterscheidet zwischen Wunsch und Entscheidung. Der Wunsch gehe auf das Endziel. Z. B. wünsche sich der Mensch Gesundheit. Die Entscheidung richte sich hingegen nicht auf das Endziel, sondern auf „die Mittel zum Ziel.“ So sei z. B. Gegenstand der Entscheidung, spazieren zu gehen, um gesund zu bleiben.
Aristoteles betont, dass die Entscheidung immer „an Überlegung geknüpft“ und deshalb willentlich sei.
Buch I, Kap. 18:
Aristoteles unterscheidet zwischen einer hohen und einer geringen Fehleranfälligkeit des Menschen. Der Mensch irre sich nämlich fast nie in der Feststellung des Endziels. Denn dass die Gesundheit ein Gut sei, darüber herrsche „allgemeine Übereinstimmung“. Der Mensch irre sich aber häufiger in der Bestimmung dessen, was die Mittel zur Erreichung eines Ziels seien. Z. B. sei es nicht immer leicht festzulegen, was gegessen und was nicht gegessen werden soll, um gesund zu werden.
Buch I, Kap. 19:
Aristoteles fragt danach, ob die Tugend mehr auf das Ziel oder die Mittel ziele. Seiner Meinung nach habe die Tugend die Mittel auch als ein „Anliegen“, doch ziele die Tugend mehr noch auf das Ziel. Denn die Tugend habe immer das (Sittlich-)Schöne als Ziel.
Buch I, Kap. 20:
Aristoteles charakterisiert den Tapferen als jemanden, der „darin zuversichtlich ist“, was die meisten fürchteten. Aristoteles betont, dass der Tapfere nicht auf Grund einer irrationalen Regung tapfer sein solle. So sei derjenige, der z. B. auf Grund von Begeisterung der Gefahr standhalte, nicht im eigentlichen Sinn tapfer. Denn die Tapferkeit basiere auf einem „Impuls“, der von der „Überlegung“ herkomme und das Sittlich-Schöne vorgebe.
Buch I, Kap. 21:
Aristoteles thematisiert die Besonnenheit. Die Besonnenheit beziehe sich auf das rechte Maß darin, taktile Lust zu genießen. (Besonnen ist also z. B. derjenige, der am Essen angemessen Lust hat, und deshalb weder zu viel, noch zu wenig isst.) Die Besonnenheit beziehe sich aber nicht auf die Lust, die aus dem Sehen, Hören oder Riechen komme.
Aristoteles betont, dass die Besonnenheit eine Mitte sei. Der Besonnenheit sei einerseits die Zuchtlosigkeit, andererseits die „Stumpfheit“ entgegengesetzt. Als mittlerer Habitus sei die Besonnenheit „die beste Grundhaltung.“
Ähnlich wie bei der Tapferkeit hebt Aristoteles hervor, dass die Besonnenheit auf der Überlegung beruhe.
Buch I, Kap. 22:
Aristoteles unterscheidet die vornehme Ruhe, den Jähzorn und den Stumpfsinn. Der Jähzornige zürne zu sehr; der Stumpfsinnige oder Phlegmatische zürne zu wenig. Der vornehm-Ruhige realisiere die Mitte zwischen Jähzorn und Phlegma, und zürne weder zu viel, noch zu wenig.
Buch I, Kap. 23:
Aristoteles unterscheidet den Verschwender, den Knauser und den Großzügigen. Der Verschwender gebe Geld „mehr als recht ist“ aus; der Knauser gebe zu wenig Geld aus. Der Großzügige stehe in der Mitte zwischen dem Verschwender und dem Knauser, und gebe das Geld „im rechten Maß“ aus. Deshalb sei der Großzügige zu loben, während der Verschwender und der Knauser zu tadeln seien.
Buch I, Kap. 24:
Aristoteles unterscheidet mehrere Arten von Knauserigkeit. So könne der Knauser ein Knicker, ein Kümmelspalter, ein schmutziger Raffer oder ein Geizhals sein.
Buch I, Kap. 25:
Aristoteles unterscheidet den Dummstolzen, den Engsinnigen und den Hochsinnigen. Der Dummstolze halte sich einer großen Ehre wert, die ihm tatsächlich nicht gebühre. Der Engsinnige halte sich „geringerer Dinge für wert“ als er tatsächlich wert sei. Der Hochsinnige stehe zwischen dem Dummstolzen und dem Engsinnigen „in der Mitte“; er halte sich der Ehre für wert, die ihm auch tatsächlich zustehe.
Buch I, Kap. 26:
Aristoteles unterscheidet den Engherzigen, den Großtuerischen und den Großartigen. Der Engherzige sei nicht bereit, ein großes Fest zu finanzieren, obwohl es richtig sei, es groß zu organisieren. Der Großtuerische richte ein Fest groß aus, obwohl es tatsächlich nur in einem kleinen Format stattfinden solle. Der Großartige hingegen richte nur die großen Feste auch groß aus. Der Großartige realisiere deshalb die Mitte zwischen dem Engherzigen und dem Großtuerischen, und sei lobenswert.
Buch I, Kap. 27:
Aristoteles unterscheidet den Schadenfrohen, den Neidischen und den ehrlich Empörten. Der Schadenfrohe empfinde Lust angesichts des (verdienten oder unverdienten) Unglücks eines anderen. Der Neidische empfinde Unlust, wenn er einen anderen im (verdienten oder unverdienten) Glück sehe. Der ehrlich Empörte stehe in der Mitte zwischen dem Schadenfrohen und dem Neidischen; der ehrlich Empörte empfinde Unlust, wenn jemand zu Unrecht im Glück oder im Unglück sei.
Buch I, Kap. 28:
Aristoteles unterscheidet den Selbstgefälligen, den Gefallsüchtigen und den „Mann echter Würde.“ Der Selbstgefällige wolle „mit keinem verkehren“ und deshalb auch mit niemandem sprechen. Der Gefallsüchtige pflege hingegen „mit allen“ Umgang. Der Mann echter Würde stehe in der Mitte zwischen dem Selbstgefälligen und dem Gefallsüchtigen. Denn der Mann echter Würde verkehre „nicht mit allen, sondern nur mit denen, die es wert sind“.
Buch I, Kap. 29:
Aristoteles unterscheidet den Hemmungslosen, den Verschüchterten und den Feinfühligen. Der Hemmungslose rede und handle „wie es sich gerade trifft.“ Der Verschüchterte hingegen hüte sich in seinem Reden und Handeln. Der Feinfühlige realisiere die Mitte zwischen dem Hemmungslosen und dem Verschüchterten. Denn der Feinfühlige spreche und handle wie und wann es recht sei.
Buch I, Kap. 30:
Aristoteles unterscheidet den Humorlosen, den „Hanswurst“ und den gesellschaftlich Gewandten. Der Humorlose mache keine Witze und werde zornig, wenn über ihn ein Witz gemacht werde. Der Hanswurst meine, über alles einen Witz machen zu müssen. Der gesellschaftlich Gewandte stehe in der Mitte zwischen dem Humorlosen und dem Hanswurst. Denn der gesellschaftlich Gewandte sei weder humorlos, noch mache er „auf jeden Fall“ Witze.
Buch I, Kap. 31:
Aristoteles unterscheidet den Gehässigen, den Schmeichler und den freundschaftlich Aufrichtigen. Der Gehässige verkleinere die positiven Eigenschaften des anderen. Der Schmeichler vergrößere hingegen die positiven Merkmale des anderen. Der freundschaftlich Aufrichtige stehe in der Mitte zwischen dem Gehässigen und dem Schmeichler. Denn der aufrichtige Freund werde über den anderen „weder mehr aussagen als da ist […], noch umgekehrt verkleinern“.
Buch I, Kap. 32:
Aristoteles unterscheidet den Aufschneider, den hintergründig Bescheidenen und den offenen Charakter. Der Aufschneider tue gegenüber einem anderen so, als sei mehr vorhanden als tatsächlich vorhanden sei. Insbesondere gebe der Aufschneider vor, mehr zu wissen als er tatsächlich wisse. Der hintergründig Bescheidene hingegen tue so, als sei weniger vorhanden als tatsächlich vorhanden sei. Insbesondere verheimliche der hintergründig Bescheidene sein tatsächliches Wissen anderen gegenüber. Der offene Charakter hingegen realisiere die Mitte zwischen dem Aufschneider und dem hintergründig Bescheidenen. Denn der offene Charakter sage offen, „was wirklich bei ihm vorhanden ist“ und zeige offen, was er wisse und was nicht.
Buch I, Kap. 33:
Aristoteles unterscheidet verschiedene Bedeutungen des Rechts. Recht sei zum einen das, was das Gesetz anordne. Das Gesetz ordne tugendhaftes Verhalten an, z. B. tapfer und besonnen zu sein. Zum anderen sei Recht „das Gleiche.“ „Denn Unrecht ist das Ungleiche.“ Denn wenn sich die Bürger von den Gütern den größeren Teil nähmen, vom Übel aber den kleineren Teil, dann sei das ungleich und Unrecht. Aristoteles schlussfolgert, dass wenn Recht eine Gleichheit sei, Recht auch eine „proportionale Gleichheit“ sein müsse. Wer als Partner in einer Partnerschaft viel habe, solle auch viel einbringen; wer hingegen wenig habe, müsse auch nur wenig einbringen.
Schließlich bedeute Recht auch Wiedervergeltung. Das Recht im Sinne von Wiedervergeltung diene auch „der Herstellung einer Proportion.“ Wenn jemand an einem anderen eine Körperverletzung begangen habe, so sei dem Täter nicht nur dasselbe Leid zuzufügen, sondern mehr, da er „den Anfang gemacht“ habe.
Buch I, Kap. 34:
Zu Beginn dieses letzten Kapitels von Buch I unterscheidet Aristoteles zwei Teile des rationalen Seelenteils. Zum einen gebe es den rational-überlegenden Teil, zum anderen gebe es den rational-spekulativen Teil. Aristoteles betont, dass der überlegende Teil sich auf die veränderlichen Sinnesobjekte beziehe. (Daraus kann man schlussfolgern, dass der spekulative rationale Seelenteil sich auf die unveränderlichen Dinge bezieht.)
Aristoteles weist jedem der beiden rationalen Seelenteile je eine eigene Tugend zu. Die Einsicht sei die Tugend des überlegenden Seelenteils; die philosophische Weisheit sei die Tugend des spekulativen Seelenteils. Die Einsicht habe als Gegenstand das, was sich verändere. Außerdem ordne die Einsicht an, sich gemäß des mittleren Habitus zu verhalten. Z. B. gebiete die Einsicht, tapfer zu sein. Die philosophische Weisheit beziehe sich hingegen auf die unveränderlichen Dinge. Zu den unveränderlichen Dingen zählt Aristoteles das Göttliche. (Man kann also sagen, dass das rational-spekulative Denken und die philosophische Weisheit als ihre Tugend sich auf das Erkennen der Götter bezieht.) –
Am Ende des Kapitels unterscheidet Aristoteles die naturgegebene Tugend und die vollkommene Tugend. Jemand könne aus einem irrationalen Impuls tugendhaft handeln, ohne dass das planende Element einbezogen sei. Die vollkommene Tugend sei aber erst dann gegeben, wenn zu dem Impuls zum Sittlich-Schönen auch der Entschluss durch das planende Element hinzutrete.
Buch II, Kap. 1:
Aristoteles beschreibt den gütig-Gerechten. Der gütig-Gerechte gebe dort nach, wo das Gesetz allgemein formuliert sei, und wähle dann das, „was der Gesetzgeber zwar durch Einzelbestimmungen festlegen wollte, aber nicht konnte“.
Buch II, Kap. 2:
Aristoteles charakterisiert den Verständnisvollen. Der Verständnisvolle erkenne „die vom Gesetzgeber ausgelassenen Fälle“ und verhalte sich dann gemäß dieser Einsicht wie der gütig-Gerechte.
Buch II, Kap. 3:
Aristoteles unterscheidet die naturgegebene Tugend und die vollendete Tugend. Aristoteles betont, dass die naturgegebene Tugend nur den „Impuls zum Sittlich-Schönen“ beinhalte; das planende Element sei nicht Teil der naturgegebenen Tugend. Die vollendete Tugend beinhalte sowohl den naturgegebenen Impuls zum Sittlich-Schönen als auch den Entschluss durch das planende Element. In diesem Zusammenhang klärt Aristoteles das Verhältnis von Einsicht und Tugend. Aristoteles betont nämlich, dass die Tugenden „der Einsicht Gefolgschaft“ leisteten. –
Schließlich thematisiert Aristoteles die Frage, ob Güter, wenn sie im Übermaß vorliegen, den Menschen untugendhaft machen. Ein zu großer Reichtum mache tatsächlich häufig „hochmütig“. Auch eine überdurchschnittliche Schönheit des Körpers könne den Menschen hochmütig machen. Eine überdurchschnittliche Tugendhaftigkeit mache den Menschen hingegen noch wertvoller; das größere Maß an Tugend zeichne sich dadurch aus, dass die Mitte in noch höherem Grad umgesetzt werde.
Buch II, Kap. 4:
Aristoteles unterscheidet drei seelische Phänomene des schlechten Menschen. Zu den seelischen Phänomenen des schlechten Menschen zählten die Schlechtigkeit, die Unbeherrschtheit und das tierische Wesen.
Buch II, Kap. 5:
Aristoteles führt ein Gegensatzpaar ein: nämlich den Gegensatz von tierischem Wesen und der dem tierischen Wesen entgegengesetzten Tugend. Das tierische Wesen, so Aristoteles, bedeutet „Schlechtigkeit im Übermaß.“ Die dem tierischen Wesen entgegengesetzte Tugend meine so viel wie „Vollkommenheit“, die das dem Menschen Mögliche übersteige.
Buch II, Kap. 6:
Aristoteles thematisiert die Unbeherrschtheit. Zunächst unterscheidet Aristoteles die Unbeherrschtheit im strikten Sinne von einer Unbeherrschtheit, die einen Zusatz hat. Der Unbeherrschte im strikten Sinne sei unbeherrscht im Konsum von (lustvollen) taktilen Dingen. Der im weiteren Sinne Unbeherrschte sei unbeherrscht in Bezug auf Ehre, Ruhm oder Zorn.
Der Unbeherrschte habe die richtige Überlegung in sich, das taktil Lustvolle nicht im Übermaß zu konsumieren. Doch die Begierde sei stärker als die Überlegung, und so gebe der Unbeherrschte der Lust nach.
Der Zuchtlose sei im Gegensatz zum Unbeherrschten davon überzeugt, dass der übermäßige Konsum des taktil Lustvollen auch gut für ihn sei. Die Überlegung des Unmäßigen funktioniere richtig, die des Zuchtlosen hingegen falsch. Deshalb ist nach Aristoteles der Zuchtlose schlimmer und schwerer zu heilen als der Unbeherrschte. –
Aristoteles geht noch einmal auf das tierische Wesen ein. Ein tierisches Wesen zu haben bedeute so viel wie Schlechtigkeit im Übermaß zu haben. Aristoteles betont, dass das tierische Wesen nur beim Menschen zu beobachten sei. Das tierische Wesen sei beim Tier nicht zu beobachten.
Buch II, Kap. 7:
Aristoteles thematisiert die Lust. Zu Beginn des Kapitels betont Aristoteles, dass es das Glück nicht ohne die Lust gebe. Im Folgenden zählt Aristoteles kurz die Argumente derjenigen auf, die meinen, die Lust sei kein Gut. Durch seine folgenden Feststellungen über die Lust widerspricht Aristoteles diesen Autoren. Als Erstes stellt Aristoteles fest, dass die Lust nie ein Werden sei. Denn die Lust, die vom Betrachten, Hören und Riechen komme, sei kein Werden. Aber auch die Lust, die vom Essen und Trinken komme, sei kein Werden, denn die Lust stelle sich mit dem Genießen ein. Sodann stellt Aristoteles über die Lust fest, dass es zwar minderwertige Lust (bei Tieren) gebe. Es gebe aber auch minderwertige Natur, ohne dass deshalb die Natur insgesamt minderwertig sei. Dasselbe gilt, so Aristoteles, auch für die Lust.
Schließlich stellt Aristoteles über die Lust fest, dass sie nicht den Menschen daran hindere, das Sittlich-Schöne zu verwirklichen. Im Gegenteil: Die Lust sei eine Begleiterscheinung der Tugend, und lasse den tugendhaften Menschen auch in Zukunft tugendhaft handeln. –
Zum Ende des Kapitels behandelt Aristoteles das Verhältnis von rationalem Element und irrationalem Element in der Seele. Zunächst betont Aristoteles, dass das rationale Element, das in der richtigen Verfassung sei, immer „das Beste“ anordne. Über die irrationalen Regungen sagt Aristoteles, dass sie „mit Leichtigkeit“ dem folgten, was das rationale Element angeordnet habe. (Aus der Beschreibung dieser Reihenfolge könnte man meinen, dass das rationale Element der „Anfang“ der Tugend sei.) Im Folgenden stellt Aristoteles klar, dass das rationale Element nicht „Anfang und Führer der Tugend“ sei. Denn zuerst entstehe „ein gewisser irrationaler Impuls in Richtung auf das (Sittlich-)Schöne in uns“, bevor „das rationale Element die Sache zur Abstimmung und Entscheidung“ bringe.
Buch II, Kap. 8:
Aristoteles thematisiert die Schicksalsgunst und den vom Schicksal Begünstigten. Schicksalsgunst liege dann vor, „wenn es einem wider seine eigene Berechnung begegnet ist, daß er Wertvolles zustande brachte“ oder er „aller Berechnung zufolge Schaden hätte haben müssen“, er aber Gewinn gehabt habe. Dementsprechend sei der vom Schicksal Begünstigte derjenige, „welcher ohne rationale Steuerung einen Impuls in Richtung auf Güter hat und diese auch erlangt.“
Buch II, Kap. 9:
Aristoteles thematisiert den Edlen und Wertvollen. Der Edle und Wertvolle sei der tugendhafte Mensch. Der Edle und Wertvolle empfinde das Wertvolle, z. B. ein hohes Amt, „in seinem ganzen Umfang“ als wertvoll und werde durch das Wertvolle „nicht verdorben“.
Buch II, Kap. 10:
Aristoteles thematisiert das Handeln gemäß der richtigen Planung. Aristoteles betont, dass der Mensch gemäß der richtigen Planung handle, wenn der rationale Seelenteil vom irrationalen Seelenteil nicht daran gehindert werde, „das ihm eigentliche Werk zu leisten“.
Buch II, Kap. 11:
Aristoteles thematisiert die Freundschaft. Zu Beginn des Kapitels behandelt Aristoteles das Verhältnis von Glück und Freundschaft. Er betont, dass die Freundschaft „zum Glück mithinzugenommen werden“ müsse, denn sie sei „in jedem günstigen Augenblick gegenwärtig“ und „ein Gut“.
Im Folgenden unterscheidet Aristoteles drei Arten von Freundschaft: die Tugend-Freundschaft, die Lust-Freundschaft und die Nutzen-Freundschaft. Die Tugend-Freundschaft beinhalte den Willen, „mit keinem anderen“ zusammenzuleben. Denn die Tugend-Freunde verhielten sich nicht nur untereinander tugendhaft, sondern seien sich aufgrund ihrer Tugendhaftigkeit auch angenehm und nützlich. Außerdem wünschten sich die Tugend-Freunde, dass der andere „alles Gute“ und ein glückliches Leben habe. Die Tugend-Freundschaft sei die sicherste, „bleibenste und schönste Freundschaft“.
Eine zweite Art von Freundschaft sei die Lust-Freundschaft. Auf die Lust-Freundschaft geht Aristoteles kaum ein. Er betont aber, dass diese Art der Freundschaft weniger beständig als die Tugend-Freundschaft sei, denn wenn die Lust des einen Partners am anderen wegfalle, zerbreche damit auch die Freundschaft.
Eine dritte Art von Freundschaft sei die Nutzen-Freundschaft. Aristoteles betont, dass Nutzen-Freunde häufig Ungleiche seien. So sei in der Nutzen-Freundschaft z. B. der Arme mit dem Reichen oder der Untugendhafte mit dem Tugendhaften befreundet. Denn der Untugendhafte erhoffe sich, durch den Tugendhaften zu größerer Tugend zu kommen.
Ähnlich wie die Lust-Freundschaft sei auch die Nutzen-Freundschaft in ihrem zeitlichen Fortbestehen unsicher. Denn falle der Nutzen aus der Sicht eines der Freunde weg, löse sich auch die Freundschaft auf. –
Zum Ende des Kapitels behandelt Aristoteles die Freundschaft mit sich selbst. Aristoteles betont, dass Freundschaft mit sich selbst bedeute, dass die Seelenteile „nicht entzweit“ seien. (Aristoteles geht dabei wohl davon aus, dass der Mensch einen rationalen Seelenteil und einen irrationalen Seelenteil hat. Nur wenn der irrationale Seelenteil dem rationalen Seelenteil folgt, sind beide Seelenteile „nicht entzweit“.) Nur der tugendhafte Mensch habe eine Freundschaft mit sich selbst. Der Schlechte sei hingegen „niemals sich selber Freund“, denn er liege „unaufhörlich mit sich im Streite“.
Buch II, Kap. 12:
Aristoteles thematisiert das Wohlwollen und die Eintracht. Das Wohlwollen richte sich auf das, was jemand selbst hervorgebracht habe. So empfinde z. B. der Vater für seinen Sohn Wohlwollen. Wenn sich das Wohlwollen auf Fremde beziehe, dann immer auf solche, die besonders tugendhaft seien. Aristoteles betont, dass das Wohlwollen „als Anfang der Freundschaft“ gelten dürfe.
Neben dem Wohlwollen thematisiert Aristoteles die Eintracht. Auch sie habe – wie das Wohlwollen – einen Bezug zur Freundschaft. Aristoteles sagt, dass Eintracht unter Bürgern immer dann bestehe, wenn die Bürger sich einig seien, wer ein hohes Amt bekleiden soll.
Buch II, Kap. 13:
Aristoteles behandelt die Frage, was „selbstliebend“ bedeutet. Am Anfang des Kapitels definiert Aristoteles denjenigen als selbstliebend, der „alles um seiner selbst willen tut, in Sachen, wo es um den Vorteil geht.“ Anschließend stellt Aristoteles fest, dass selbstliebend ein Merkmal der schlechten Menschen sei. Denn alles, was der Schlechte tue, tue er „nur für sich“. Der Tugendhafte sei hingegen nicht selbstliebend. Denn der Hochwertige handle (auch) „im Interesse des anderen“.
Buch II, Kap. 14:
Aristoteles führt das Thema der Selbstliebe weiter aus. Aristoteles betont, dass der Tugendhafte sich zu Recht als „ein wertvoller Mensch“ liebe. Der Schlechte habe aber keine „anziehende Eigenschaft“, wegen der er sich mit Recht selbst lieben könne. Wenn der Schlechte sich, ohne eine gute Eigenschaft zu besitzen, selbst liebe, so sei dies Selbstliebe.
Buch II, Kap. 15:
Aristoteles betont die Bedeutung, Freunde zu haben. Zum einen sei der Freund wichtig, um sich selbst erkennen zu können. Man könne sich im Freund selbst erkennen, da der gute Freund „ein zweites Ich“ sei. Zum anderen sei der Freund notwendig, um Wohltaten erweisen zu können. Schließlich sei der Freund wichtig, um nicht allein „dahinleben“ zu müssen.
Buch II, Kap. 16:
Aristoteles thematisiert die Zahl der Freunde, die man haben soll. Am Anfang des Kapitels sagt Aristoteles, dass man weder viele, noch wenige Freunde haben solle. Der Mensch solle nicht zu viele Freunde haben, denn sonst könne er nicht jedem Freund die ihm angemessene Zuneigung zuteilwerden lassen. Außerdem solle man auch deshalb nicht zu viele Freunde haben, da bei vielen Freunden auch immer jemandem ein „Mißgeschick“ passiere, weshalb der Freund sich sorge.
Andererseits solle der Mensch auch nicht zu wenige Freunde haben. Aristoteles empfiehlt wohl mindestens zwei Freunde zu haben.
Buch II, Kap. 17:
Aristoteles unterscheidet eine Freundschaft unter Gleichen und eine Freundschaft unter Ungleichen. Zu einer Freundschaft unter Ungleichen zähle z. B. die Freundschaft zwischen Vater und Sohn oder die Freundschaft zwischen Mann und Frau. Gleiche Freunde würden mit gleicher Leistung rechnen. Erfolge die gleiche Leistung nicht, so resultiere daraus eine Beschwerde. Ungleiche Freunde würden hingegen nicht mit gleicher Leistung rechnen. Aristoteles schlussfolgert nun aus der Tatsache, dass Ungleiche nicht die gleichen Leistungen verlangen würden, dass ungleiche Freunde „mit Beschwerden der genannten Art nichts zu tun“ hätten.
Schluss:
Aristoteles behandelt in der Magna Moralia das Glück als zentrale Frage. In Buch I, Kapitel 2 bestimmt Aristoteles, dass wenn verschiedene Güter als „Teilziele“ vorlägen, diese zum Glück als höchstem Gut und „Vollziel“ führten. Zu den Teilzielen zählt Aristoteles die Einsicht und die Gerechtigkeit. Allein aus dieser Bestimmung, dass Einsicht und Gerechtigkeit zum Glück führten, zeigt sich, dass für Aristoteles das Glück ganz wesentlich auf den dianoetischen (kognitiven) und ethischen (charakterlichen) Tugenden basiert. Denn die Einsicht sei eine dianoetische Tugend (vgl. Buch I, Kapitel 5 und Buch I, Kapitel 34). Die Gerechtigkeit sei hingegen eine ethische Tugend, d. h. eine Tugend des irrationalen Seelenteils (vgl. Buch I, Kapitel 5).
Zu den äußeren Gütern, die ebenfalls zum Glück beitrügen, zählt Aristoteles in der Magna Moralia nur die Freundschaft auf. In der Nikomachischen Ethik erwähnt Aristoteles neben der Freundschaft auch die Gesundheit und einen mittleren Besitz.
Aristoteles hebt in Buch II, Kapitel 15 hervor, dass die Freundschaft für das Glück notwendig sei. Insbesondere sei der gute Freund wichtig, um Wohltaten erweisen zu können, um in ihm als zweitem Ich sich selbst erkennen zu können, und, um mit ihm zusammenzuleben.
Felix H.
Literatur:
Aristoteles: Magna Moralia, übersetzt und kommentiert von Fr. Dirlmeier, in: Aristoteles, Werke in deutscher Übersetzung, begründet von E. Grumach, hrsg. von H. Flashar, Bd. 8, Berlin 51983.